Soziale Arbeit und Neoliberalismus heute – schwarz auf weiß

Mein neues Buch „Soziale Arbeit und Neoliberalismus heue – schwarz auf weiß“ erscheint im Juli 2025.
Es ist in gewissem Sinn die Fortsetzung meines Bandes „Schwarzbuch Soziale Arbeit“.
Hier das Vorwort:
Vor ein paar Wochen fragte ich eine Gruppe SozialarbeiterInnen[1] , ob sie sich auf das, was sie heute tun und in der Arbeit erleben, durch ihr Studium vorbereitet fühlen, kam mir ein vielstimmiges, einvernehmliches „Nein“ entgegen.
Man fragt sich verwundert, was da los ist. Wie kann eine Hochschulausbildung es dermaßen verpassen, die dem Studium folgende Praxis und ihre Aufgabenstellungen in ihre Lehrkonzepte angemessen zu integrieren? Wenn nicht ihre Ausbildung sie darauf vorbereitet, was sie als Berufstätige tun und leisten müssen und was sie erwartet, wer tut es dann? An wen hat die Profession ihre Deutungshoheit abgegeben?
Bei einem Vortrag vor PraktikerInnen in allerjüngster Zeit, in dem ich auf die Gefahr der Deprofessionalisierung der Sozialen Arbeit durch die neoliberale Transformation hingewiesen hatte, meinte eine Zuhörerin, es sei aber doch notwendig, dass jemand auf die SozialarbeiterInnen aufpasse: ‚Man könne doch nicht zulassen, dass sie einfach so arbeiten, wie es ihnen in den Kopf kommt.‘
Ich muss gestehen, dass mir einen Moment die Luft wegblieb. Ist der Prozess der Enteignung der Sozialen Arbeit als Profession schon so weit vorangekommen?
Soziale Arbeit liegt mir am Herzen, ich habe 36 Jahre meines Lebens beruflich damit zugebracht und mich darüber hinaus noch viele Jahre politisch für eine humanistisch orientierte Soziale Arbeit engagiert.
Nach der Verabschiedung des neuen Kinder- und Jugend-Stärkungsgesetzes (KJSG) im Jahr 2021 und der endgültigen Verbannung des sozialpädagogischen Kinder- und Jugendhilfe-Gesetzes schien es mir, als hätte sich die Stimmung in der kritischen Sozialen Arbeit verändert:
Man hatte sich dagegen gewehrt, neoliberal überrollt zu werden. Man hatte lange gekämpft und Zwischenerfolge erreicht. Aber am Ende hatte man verloren. Und man richtete sich – enttäuscht, wütend oder auch voller bereitwilliger Anpassung – darauf ein, die neoliberale Grundlage der Sozialen Arbeit als das nun endgültig Gegebene und nicht mehr Veränderbare hinzunehmen – und eben das Beste daraus zu machen.
Inzwischen gibt es hier und da wieder kritische Stimmen, aber das Wort Neoliberalismus sucht man in all diesen Äußerungen fast völlig vergebens. Was selbstverständlich ist, muss man nicht erst erwähnen? Wenn klar ist, dass sich die Sonne um die Erde dreht, dann hat es keinen Sinn, sich ständig daran zu stoßen. So ist es halt.
Als ich vor 13 Jahren das „Schwarzbuch Soziale Arbeit[2]“ geschrieben habe, schien die neoliberale Entwicklung noch wenig real, sie wurde zwar von etlichen AutorInnen als Bedrohung gesehen, als potenziell grundsätzliche Veränderung. In vielen Praxisfeldern war sie damals aber noch wenig sichtbar, in anderen allerdings schon.
Zwar gab es auch in dieser Zeit schon SozialarbeiterInnen, die versuchten die aufbrechenden Probleme zu ignorieren und auch solche, die sich bereits mit diesen Entwicklungen angefreundet hatten. Aber es gab deutlich mehr SozialarbeiterInnen als heute, die noch eine andere Arbeit in ihrem Berufsleben erlebt hatten, und die die Unterschiede zwischen ihren bisherigen Erfahrungen und den modernisierten Tendenzen noch wahrnehmen und als Folgen der neoliberalen Transformation erkennen konnten.
Heute ist die Lage eine andere. Die meisten PraktikerInnen wissen gar nicht mehr, wie Soziale Arbeit aussehen kann, wenn man ihr die erforderlichen Arbeitsbedingungen bietet und die SozialarbeiterInnen so arbeiten lässt, wie sie es als professionelle Fachkräfte könnten.
Heute, 14 Jahre nach Erscheinen der 1. Auflage des Schwarzbuches, stelle ich fest, dass das, was ich zurzeit über die Praxis erfahre, meine damaligen Beispiele und Bedenken mitunter deutlich übertrifft. Und was mich besonders erschreckt: Die neoliberale Transformation wird inzwischen offensichtlich nicht mehr als Herausforderung erlebt, sondern als unumgehbare Realität.
Die neoliberale Ideologie versucht heute – so könnte man es interpretieren – den SozialarbeiterInnen die ‚alten sozialarbeiterischen Sorgen von den Schultern zu nehmen‘: Ihre VertreterInnen müssen sich jetzt nicht mehr darum bemühen, die Hintergründe der Probleme ihre Klientel zu ergründen, sie müssen sich nicht mehr den Kopf zerbrechen, wie sie die von ihnen begleiteten Menschen dabei unterstützen können, ihr Lebens selbst zu bewältigen.
SozialarbeiterInnen, die dieses neoliberale „Angebot“ annehmen, müssen sich nicht mehr mit Gedanken über die gesellschaftlichen Ursachen der Problemlagen der KlientInnen und auch nicht mehr mit dem Wissen um deren soziale Benachteiligung belasten. Für sie gibt es auch keinerlei Widersprüche zwischen dem, was sie eigentlich aus ethischen Gründen für richtig halten und dem, was der Staat von ihnen verlangt. Es irritiert sie auch nicht einmal mehr, dass sie im Auftrag des Staates Probleme aus der Welt schaffen sollen, die ständig neu produziert aber in keiner Weise ursächlich bekämpft werden.
Und der diese verlockende Angebot für sich akzeptiert, der wird auch bald leichten Herzens der Bewertungsideologie neoliberaler Sozialer Arbeit folgen können: Entgegen der ethischen Vorstellung humanistisch orientierter Sozialer Arbeit hat die neoliberale Ideologie keine Hemmungen, Menschen zu bewerten und ggf. abzuwerten. So etwas gab es in der Sozialpolitik und der Sozialen Arbeit schon öfter, es ist keineswegs neu. Heute geht es aber bei der Bewertung nicht um arische und nicht-arische Menschen, auch nicht unbedingt um reiche und arme Menschen, es geht um die Aufwertung „effizienter“ Menschen und die Abwertung und Ausgrenzung solcher, die eben nicht die Leistung bringen können oder wollen, die man von ihnen erwartet.
Für eine Soziale Arbeit im Sinne des aktivierenden Staates reicht man den MitarbeiterInnen und Trägern die Hand. Der Sozialen Arbeit wird eine größere gesellschaftliche Akzeptanz und Aufwertung vorausgesagt, wenn sie sich denn endlich vollständig der neuen Konzeption anpasst. Die Protagonisten der aktivierenden Sozialen Arbeit sprechen von einem zu erwartenden deutlichen Professionalisierungsschub und locken mit der Behauptung, auf diese Weise könnten die SozialarbeiterInnen ein neues Selbstbewusstsein gewinnen und auch die bestehende Unzufriedenheit mit der eigenen beruflichen Tätigkeit überwinden.
Soziale Arbeit wird es weiterhin geben, aber sie wird nicht mehr dieselbe sein, wie die, die mir am Herzen liegt.
Dennoch kann ich es nicht lassen, gerade jetzt zu versuchen, die Hintergründe der gegenwärtigen Lage zu beleuchten und sowohl der Praxis als auch der Disziplin schwarz auf weiß vorzulegen, was zurzeit tatsächlich passiert. Vielleicht tue ich das in der vagen Hoffnung, dass die Erkenntnis über die Lage und ihre Ursachen dazu beitragen kann, dass sich die Profession ihre Kraft und ihre Relevanz für die menschliche Gesellschaft (nicht für das herrschende System und dessen neoliberale Verwertungsinteressen) wieder vergegenwärtigt, und dass die VertreterInnen von Disziplin und Praxis der Sozialen Arbeit begreifen, dass sie angesichts der Lage mehr machen müssen, als nur über diese zu reflektieren und vielleicht noch mit Ratschlägen zur „Selbstsorge“ dazu beizutragen, dass die PraktikerInnen diese Widersprüche ohne Schädigung ihrer Persönlichkeit ertragen können.
Aber es gibt noch einen anderen Grund, warum Soziale Arbeit mich immer wieder fasziniert:
Wie kaum ein anderer gesellschaftlicher Bereich ist sie Spiegelbild unserer Gesellschaft und zeigt wie ein Seismograf die aktuellen politischen Entwicklungen an. Sie hat riesige Potentiale als Kritikerin der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Sicherlich, sie ist Teil des Staates aber gleichzeitig auch – wie niemand sonst – mit den Schicksalen und Problemen derjenigen Menschen konfrontiert, die in dieser Gesellschaft eben nicht zu denen gehören, die leistungsstark sind und damit das große Los gewonnen haben. Niemand hat so intime und spezielle Kenntnisse über das, was in unserer Gesellschaft mit Menschen passieren kann. Eigentlich liegt dort ein Riesen-Schatz an Wissen und Erfahrung vor, den aber scheinbar keiner haben will, denn es genügt offenbar allen, wenn SozialarbeiterInnen praktische Aufgaben übernehmen. Was sie wissen und denken wird nicht erfragt.
Nach Veröffentlichung meines Schwarzbuches wurde ich von zustimmenden Mails aus der Praxis überschwemmt. Sozialarbeitende teilten mit, wie froh sie waren, dass endlich jemand das aussprach, worunter sie seit Jahren litten und was ihnen zusetzte. Das Buch kam in der Praxis gut an. Die Disziplin dagegen hielt sich vornehm zurück, die WissenschaftlerInnen haben längere Zeit versucht, das Buch zu ignorieren, weil es ihnen nicht „wissenschaftlich genug“ schien.
Es unterschied sich tatsächlich vor allem in mehreren Punkten von den vielen wissenschaftlichen, kritischen Texten, die in Zeitschriften und Büchern publiziert wurden:
- Das Buch war in verständlicher Sprache geschrieben.
- Es orientierte den Blick auf die Praxis und die dort entstandenen Problemlagen.
- Ich scheute mich nicht, konkrete Praxisbeispiele zu benennen, ja sogar eigene Erfahrungen mit den neoliberalen Veränderungen und Herausforderungen in die Betrachtung einzubeziehen.
- Und schließlich nahm der Text eindeutig Stellung und forderte eine Re-Politisierung der Sozialen Arbeit.
Das vorliegende Buch hat den gleichen Anspruch und ich hoffe, dass vor allem SozialarbeiterInnen es lesen und damit arbeiten werden.
- Oranienburg 11.2 2025
- Mechthild Seithe
[1] Um die Lesbarkeit zu sichern und außerdem der Tatsache zu entsprechen, dass die absolute Mehrheit der hier im Buch angesprochenen KollegInnen der Sozialen Arbeit weiblich sind, habe ich mich entschlossen für dieses Buch die Form „Innen“ und ansonsten das feminine Generikum zu benutzen. Männer und Personen diverser und anderer Geschlechter sind selbstverständlich mitgemeint.
[2] Seithe, M. (2012): Schwarzbuch Soziale Arbeit. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer VS Verlag.
Zur Orientierung das Inhaltsverzeichnis
Inhalt
1 Kapitel Einleitung ………………………………………………………………………………………………………
1.1 Eine erstaunliche Diskrepanz
1.2 Die beiden konzeptionellen Hauptströmungen der gegenwärtigen Sozialen Arbeit
1.3 Unterschiedliche Blickrichtungen einer kritischen Bewertung der gegenwärtigen Sozialen Arbeit
1.4 Politische Einschätzung der beiden Konzepte
1.5 Herangehen an die aufgeworfenen Fragestellungen
2 Kapitel Analyse aktueller Methoden-Lehrbücher …………………………………………………………….
2.1 Untersuchung aktueller Methoden-Lehrbücher
2.2 Ergebnisse
2.2.1 Ergebnis: Aussagen zum geltenden professionellen Konzept ………………………………………..
2.2.2 Ergebnis: Umgang mit der Thematik der neoliberalen Herausforderung
3 Kapitel: Geschichte staatlicher und beruflicher Konzeptentwicklung in der Sozialen Arbeit ..
3.1 Entstehung und Entwicklung der verschiedenen Handlungskonzepte
3.1.1 Sozialpolitische Grundeinstellungen in den Anfängen der Armenhilfe ……………………………
3.1.2 Antwort des Staates auf die Soziale Frage zu Beginn der Industrialisierung
3.1.3 Die Entstehung der ersten professionellen Konzepte …………………………………………………..
3.1.4 Konzeptentwicklung in der Phase der Herausbildung der Profession Soziale Arbeit
3.1.5 Die Entwicklung des professionellen Konzeptes bis zum Ende des Postfordismus
3.2 Soziale Arbeit im Zusammenwirken von staatlichem und professionellem Konzept
3.2.1 Funktionszuweisung des Staats an die zur Soziale Arbeit ………………………………………………
3.2.2 Grenzen der Dienstbarkeit für die Interessen des kapitalistischen Staates ……………………..
3.2.3 Die Grundstruktur: staatlich finanzierte Sozialer Arbeit und Staat
3.2.4 Soziale Arbeit zwischen Ordnungspolitik und Menschlichkeit
3.3 Die „Lebensweltorientierung“ als neues, grundlegendes Handlungskonzept der Profession
3.3.1 Allgemeine Darstellung des Konzeptes ……………………………………………………………………….
3.3.2 Abgrenzungen gegenüber früheren und alternativen Konzepten Sozialer Arbeit …………….
3.3.3 Weiterentwicklung des neuen Konzeptes …………………………………………………………………..
4 Kapitel Vergleich der Konzepte
4.1 Fragestellung des Vergleiches
4.1.1 Inhaltliche Spezifik des Vergleiches ……………………………………………………………………………
4.1.2 Modelle der beiden Handlungskonzepte als Grundlagen für den Vergleich …………………….
4.1.3 These zur Frage der Kompatibilität der beiden verschiedenen Konzepte ………………………..
4.2 Methodische Vorüberlegungen
4.2.1 Theorie – Konzept – Methoden – worum geht es bei dem Vergleich? ……………………………..
4.2.2 Konzept-Aspekte als Hilfskonstruktion für den differenzierenden Vergleich
4.3 Vergleich Aspekt 1: Aufgabenverständnis, Mandat, Erwartungen
4.3.1 Aufgaben Sozialer Arbeit ………………………………………………………………………………………….
4.3.2 Mandate der Sozialen Arbeit – das staatliche und das „Doppelte“ Mandat …………………….
4.3.3 Das Verhältnis der Profession zum staatlichen Mandat ………………………………………………..
4.3.4 Erwartungen der KlientInnen an die Soziale Arbeit
4.4 Vergleich Aspekt 2: Problemlagen der Klientel und deren Ursachen und Lösungsmöglichkeiten
4.1 Problemlagen, die die Soziale Arbeit auf den Plan rufen ………………………………………………
4.4.2 Allzuständigkeit und Spezialisierung
4.4.3 Die Bedeutung der gesellschaftlichen Verhältnisse für die Problemlagen ……………………….
4.4.4 Einbeziehung der gesellschaftlichen Problemhintergründe bei der Lösungssuche
4.4.5 Persönliche Probleme und Leidensdruck …………………………………………………………………….
4.5 Vergleich Aspekt 3: Menschenbilder
4.5.1 humanistisches versus ökonomisches Menschenbild …………………………………………………..
4.5.2 Die Bedeutung von Ethik, Empathie und Respekt ………………………………………………………..
4.5.3 Annahmen über die Wertigkeit der Subjekte ………………………………………………………………
4.5.4 Autonomie, Selbstaktualisierung und Selbststeuerung …………………………………………………
4.6 Vergleich Aspekt 4: Menschen und Gesellschaft und Umwelt
4.6.1 Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft …………………………………………………………
4.6.2 Das Verhältnis von Individuum und Umwelt
4.6.3 Neoliberalen Sicht auf das Verhältnis Individuum und Umwelt bzw. Gesellschaft
4.7 Vergleich Aspekt 5: Selbsthilfe und Selbstermächtigung als Perspektiven Sozialer Arbeit
4.8 Vergleich Aspekt 6: Struktur der sozialarbeiterischen Interaktion…………………………………………
4.8.1 Verhältnis zwischen KlientIn und SozialarbeiterIn im Rahmen der Interaktion
4.8.2 Charakter der Zusammenarbeit ……………………………………………………………………………….
4.9 Vergleich Aspekt 7: Der sozialarbeiterische Prozess
4.9.1 Aktivierung und Motivierung …………………………………………………………………………………..
4.9.2 KlientIn, AdressatIn oder KundIn? ……………………………………………………………………………
4.9.3 Umgang mit nicht-motivierten KlientInnen ……………………………………………………………….
4.9.4 Sozialarbeiterische Tätigkeit als Form des „Regierens“ ……………………………………………….
4.10 Vergleich Aspekt 8: Komplexität, Struktur und Methodik
4.10.1 Strukturelle Offenheit oder Standardisierbarkeit ……………………………………………………….
4.10.2 Reflexion, Wissenschaft und Hermeneutik ………………………………………………………………..
4.10.3 Standardisierter und reflexiver Handlungsmodus ………………………………………………………
4.11 Vergleich Aspekt 9: Methoden und Methodenwahl
4.11.1 Methoden und Methodenwahl nach dem professionellen Konzept ……………………………..
4.11.2 Methoden und der Methodenwahl im neoliberalen Konzept ………………………………………
5 Kapitel Soziale Arbeit und Staat im Kapitalismus …………………………
5.1 Die Macht des Staates gegenüber der Sozialen Arbeit
5.2 Der postfordistische und der neoliberale Staat und „ihre“ jeweilige Soziale Arbeit
5.2.1 Postfordistischer Staat und Soziale Arbeit …………………………………………………………………
5.2.2 Soziale Arbeit im neoliberalen Staat …………………………………………………………………………
6 Kapitel Die Auswirkungen der neoliberalen Staatsmacht auf die Soziale Arbeit .
6.1 Die gedeckelte Finanzierung des Sozialbereiches
6.2 Setzen von Prioritäten in der Sozialen Arbeit
6.3 Sparstrategien im Bereich Soziale Arbeit
6.3.1 Senkung der Personalkosten …………………………………………………………………………………..
6.3.2 Prekäre Arbeitsplätze……………………………………………………………………………………………..
6.3.3 Vorenthalten der für professionelle Arbeit erforderlichen Rahmenbedingungen …………..
6.3.4 Bezahlung unter Ausbildungsniveau …………………………………………………………………………
6.4 Schaffung von neoliberalen gesetzlichen Grundlagen, Richtlinien und Verfügungen
6.5 Soziale Arbeit und Marktorientierung
7 Kapitel Die Neue Steuerung und ihre Folgen für die Soziale Arbeit
7.1 Perspektive: betriebswirtschaftliche Steuerung
7.2 Das neoliberale Geschäftsverhältnis zwischen Kostenträger und Sozialbetrieb
7.2.1 Kontraktmanagement …………………………………………………………………………………………….
7.2.2 Leistungsvereinbarung ……………………………………………………………………………………………
7.3 Die neue Finanzierung und ihre Konsequenzen
7.3.1 Prospektive Kostenvereinbarung ……………………………………………………………………………..
7.3.2 Diskontinuierliche Refinanzierung ……………………………………………………………………………
7.3.3 Budget-Haushalt ……………………………………………………………………………………………………
7.3.4 Dezentrale Ressourcenverantwortung ……………………………………………………………………..
7.3.5 Fundraising und Sponsoring ……………………………………………………………………………………
7.4 „Knappe Kassen“ als Prinzip und die Folgen für die professionelle Soziale Arbeit
7.5 Freie Träger als abhängige Unternehmer und die Folgen
7.5.1 Freie Träger als abhängige Dienstleister ……………………………………………………………………
7.5.2 Freie Träger müssen Unternehmer werden ………………………………………………………………
7.5.3 Die gewollte Konkurrenz durch „Wettbewerb“ ………………………………………………………….
7.6 Effektivität und Effizienz als bestimmende Größen der Neuen Steuerung
7.6.1 Effektivität und Effizienz als betriebswirtschaftliche Komponenten ……………………………..
7.6.2 Zum Verhältnis von Effizienz und Effektivität im Rahmen der Neuen Steuerung ……………
7.7 Die Folgen des unabdingbaren Effizienzgebotes
7.7.1 Nachrangigkeit fachlicher Entscheidungskriterien ……………………………………………………..
7.7.2 Aufforderung, ständig die eigene Effizienz zu belegen ………………………………………………..
7.7.3 Chronischer Zeitdruck …………………………………………………………………………………………….
7.7.4 Folgen der Dominanz des Effizienzprimates für die Hilfeentscheidungen ……………………..
7.8 Steuerung und Controlling des Produktionsprozesses und die Folgen……………………………………
7.8.1 Standardisierung und Planung …………………………………………………………………………………
7.8.2 Qualitätsmanagement a la BWL und Dokumentation …………………………………………………
7.9 Output, Wirkungsorientierung und Wirkungsnachweis
7.9.1 Output – der neoliberale Erfolg ……………………………………………………………………………….
7.9.2 Wirkungsorientierung und Wirkungsnachweis …………………………………………………………..
7.9.3 Evidenzbasierung der Sozialen Arbeit ……………………………………………………………………….
7.9.4 Attraktivität der Wirkungsorientierung für die Kostenträger ……………………………………….
7.10 Bürokratie statt Unterstützung
8 Kapitel: Die Folgen der Dominanz des neoliberalen Konzeptes
8.1 Individuelle Problemlagen statt gesellschaftlicher Verantwortung
8.2 Employability statt Bewältigung des Lebens
8.3 Ordnungspolitik statt Sozialpädagogik
8.4 Geschäftsverhandlung statt dialogischem und förderlichem Umgang
8.5 Aktivieren und Erziehen statt motivieren und vitalisieren
8.6 Verschlechterung der Leistungen statt tatsächliche Unterstützung der Klientel
8.7 Marktkonforme Dienstleistung statt interpersonalem Geschehen
8.8 Deprofessionalisierung statt Stärkung der Profession
8.8.1 Kein Vertrauen in die Professionalität der SozialarbeiterInnen ……………………………………
8.8.2 Professionelle Fachlichkeit ist nicht mehr erwünscht und wird ignoriert ………………………
8.8.3 Tendenzielle Ablehnung der Profession Soziale Arbeit ……………………………………………….
8.9 Effiziente oder ineffiziente Kunden statt gleichwertiger Menschen
9 Kapitel Die eigenen Anteile der Profession an ihrer Neoliberalisierung …
9.1 Distanzierung von der Sozialen Frage
9.2 Dienstleistungsorientierung
9.3 Distanzierung von der klassischen Zielgruppe
9.4 Die Abschaffung des sogenannten Doppelten Mandates
9.5 Neoliberaler Gerechtigkeitsbegriff
10 Kapitel Wie sieht es heute in der Praxis aus?
10.1 Wieweit zeigt sich die neoliberale Transformation in den heutigen Abläufen?
10.2 Der Prozess der Anpassung über die Adaption der Begriffe
10.2.1 Umerziehung durch den Gebrauch fremder Begriffe ………………………………………………….
10.2.2 Adaption der betriebswirtschaftlichen Begriffe …………………………………………………………
10.2.3 Zulassen der Enteignung der fachlichen und ethischen sozialpädagogischen Begriffe
10.2.4 Tabuisierung zentraler sozialpädagogischer Begriffe ………………………………………………….
11 Kapitel Die Reaktionen der Profession auf die neoliberale Umsteuerung
11.1 Zum Thema herrscht weitgehend Schweigen
11.1.1 Verzicht auf eine selbstbewusste Haltung gegenüber den neoliberalen Vorgaben …………
11.1.2 Der Charme des Neoliberalismus …………………………………………………………………………….
11.1.3 Festhalten am professionellen Konzept und seiner Ethik – aber nur im Hinterkopf
11.1.4 Illusionäres Pochen auf die Unverwundbarkeit der eigenen Profession ………………………..
11.2 Die Illusion einer bunten, heilen Welt der Profession
11.3 Die kritischen Stimmen
12 Kapitel PraktikerInnen – Belastungen und Interpretation der Ursachen …
12.1 Psychische Belastung der SozialarbeiterInnen in der heutigen Praxis
12.2 Die Wahrnehmung von Belastungsfaktoren
12.2.1 Bewertung der Belastungsfaktoren durch die PraktikerInnen selbst …………………………….
12.2.2 Vermutete Ursachen und Auslöser der bestehenden Belastungen ………………………………
12.2.3 Nicht-Beachtung der Folgen der neoliberalen Transformation – Hintergründe
12.3 Hoffnungsträger Praxis – Warum bewegt sich da nichts?
13 Kapitel Bewältigungsstrategien angesichts der neoliberalen Transformation
13.1 Der Umgang der Profession mit Widersprüchen
13.2 Strategien der moralischen Desensibilisierung
13.3 Bewältigungsstrategien in Praxis und Disziplin der gegenwärtigen Sozialen Arbeit
13.3.1 Verarbeitungsweise 1: Nichtwahrnehmung der Widersprüche ……………………………………
13.3.2 Verarbeitungsweise 2: Antworten auf erkannte Widersprüche ……………………………………
13.3.3 Verarbeitungsweise 3: Illusion von der Auflösbarkeit der Widersprüche ………………………
13.3.4 Verarbeitungsweise 4: Versuche der praktischen Negation …………………………………………
13.3.5 Verarbeitungsweise 5: Einsicht in die Unauflösbarkeit der Widersprüche …………………….
14 Kapitel Der ausgebremste Widerstand der Praxis
14.1 Die Faktoren, die Kritik und Widerstandsbereitschaft verhindern
14.2 Schonungslose und eindeutige Aufklärung statt Verharmlosung
14.3 Sensibilisierung statt moralischer Desensibilisierung
14.3.1 Aufgeben der moralischen Desensibilisierung ……………………………………………………………
14.3.2 Das unzutreffende neoliberale Narrativ von der erforderlichen Distanz ……………………….
14.3.3 Zurückweisung der Entfremdung vom humanistischen Menschenbild
14.4 Wer ist hier gefordert? Aufforderungen an Disziplin und Lehre
15 Kapitel Überlegungen für ein neu kalibriertes Konzept Sozialer Arbeit …
15.1 Strukturelle Anforderungen an ein neukalibriertes, kritisches, professionelles Konzept
15.1.1 Gültigkeit der konzeptionellen Aussagen für alle Arbeitsfelder ……………………………………
15.1.2 Einbettung in ein ganzheitliches Gesellschaftskonzept ……………………………………………….
15.1.3 Kein Tabu: Infrage-Stellen der sozialpolitischen Verhältnisse ………………………………………
15.1.4 Die Konzeption muss mehr sein als ein unerreichbares Ideal. ……………………………………..
15.2 Inhaltliche Neukalibrierung des professionellen Konzeptes
15.2.1 Ablehnung der neoliberalen Inhalte …………………………………………………………………………
15.2.2 Übernahme von Inhalten des bestehenden Konzeptes ……………………………………………….
15.3 Diskussion von neu zu bedenkenden Inhalten
15.3.1 Rückbesinnung auf die Soziale Frage ………………………………………………………………………..
15.3.2 Einbeziehung aller Bereiche der Lebenswelt ……………………………………………………………..
15.3.3 Keine Verabsolutierung der Ablehnung der eigenen fachlichen Expertise …………………….
15.3.4 Die erforderliche Selbstermächtigung der Profession Soziale Arbeit …………………………….
16 Kapitel Kritik und Widerstand – einige Anregungen
16.1 Aber kann Soziale Arbeit überhaupt politisch wirken?
16.2 Reflexion als Kritik der Verhältnisse
16.3 Einmischen
16.3.1 Öffentlichkeitsarbeit und Einmischen – Möglichkeiten der Praxis
16.3.2 Einmischen der Disziplin …………………………………………………………………………………………
16.4 Tarifverhandlungen und Kämpfe um bessere Arbeitsbedingungen
16.5 Widerstand und Widerspruch am Arbeitsplatz
16.5.1 Subversiver Widerstand am Arbeitsplatz ………………………………………………………………….
16.5.2 Offener Widerstand am Arbeitsplatz und im Arbeitsalltag …
17 Fazit: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Die Generationen der heutigen SozialarbeiterInnen, die in die pseudofachliche neoliberale Ideologie schon hineingewachsen sind, kennen kaum noch Alternativen von sozialarbeiterischen Praxen. Wer jetzt studiert, erlebt die Praxis zwar als belastend, aber als normal, als unveränderbar und selbstverständlich. Es ist eine der Untugenden des geschichtslosen Neoliberalismus, alles, was vor ihm war, als überholt, altertümlich, konservativ und am liebsten einfach als „rechts“ zu diffamieren. Das ist mit ein Grund dafür, dass heute die Erfahrungen und Traditionen der Sozialen Arbeit wenig geschätzt und auch kaum vermittelt werden. So wird das professionelle Konzept im Rahmen der Geschichtslosigkeit auf dem Altar der Moderne geopfert. Und viele glauben, dass sei auch noch eine fortschrittliche, weil moderne Tat.
Das Festhalten und Wertschätzen des bestehenden professionellen Konzeptes Sozialer Arbeit, wie es in den von mir untersuchten Methoden-Lehrbüchern geschehen ist, kann deshalb zunächst einmal sehr wohl als positive Leistung für den Erhalt dieser Profession gewertet werden. Wenn allerdings nicht gleichzeitig die Auseinandersetzung mit den neoliberalen Herausforderungen offensiv und im Klartext betrieben wird, wird dieses Bemühen bestenfalls dazu führen, dass die ehemaligen Studierenden weiterhin sagen: „In der Hochschule haben wir so viel über Theorien und über Menschenrechte gelernt, aber was hier in der Praxis läuft, das ist was völlig anderes.“
Hier schließt sich der Kreis dieses Buches:
Die von mir untersuchten Lehrbücher haben folgende entscheidenden Merkmale:
- eine mehr oder weniger ausführliche Darstellung des professionellen, eher humanistischen Konzeptes,
- eine differenzierte Darstellung von Methoden und Methodik der Sozialen Arbeit unter Berücksichtigung der strukturellen Offenheit
- ein mehr oder weniger ausführliches Eingehen auf bestimmte Verfahren der neuen Steuerung, die neben den professionellen Methoden stehen, zum Teil als spezifisch für Organisationsfragen und nur dafür relevant gekennzeichnet,
- zum Teil kurze Abrisse über die Gefahren der neoliberalen Transformation für die Profession, eher aber nur als möglicherweise drohende Gefahr eingeschätzt und von der quantitativen und qualitativen Bedeutung her eher als marginal dargestellt,
- jedoch so gut wie keine Hinweise auf das neoliberale Menschenbild und die Bedeutung der Ideologie des aktivierenden Staates für die Soziale Arbeit und vor allem
- fast keine Auseinandersetzung mit der Frage, wie weit die vorgestellten Methoden unter den heute gegebenen Bedingungen tatsächlich umsetzbar sind,
- und keine Überlegungen dazu, ob die vorgestellten Methoden, das erwünschte spezifische methodische Herangehen, ob die Arbeitsprinzipien und die Konzepte mit dem vereinbar sind, was heute in der Praxis erwartet wird.
Nach allem, was in diesem Buch besprochen und untersucht wurde, ist insbesondere der letzte dieser Punkte problematisch und nicht dazu geeignet, in irgendeiner Weise die neoliberale Transformation zu bremsen oder auch nur infrage zu stellen.
Das vermittelte Wissen um die wirklichen Probleme und deren Ursachen wäre die allererste Voraussetzung dafür, dass die SozialarbeiterInnen später diese Widersprüche bewusst erfahren und erkennen können und sich darüber im Klaren sind, dass es Alternativen gibt und geben kann.
„Dies ist ein Vorabdruck des folgenden Werkes: Mechthild Seithe, Soziale Arbeit und Neoliberalismus heute – schwarz auf weiß, 2025, Springer VS .
Dies ist eine Version des Manuskripts vor der Annahme zur Veröffentlichung und hat keine keine redaktionelle Bearbeitung durch den Verlag durchlaufen. Die finale authentifizierte Version ist online verfügbar unter: http://dx.doi.org/[insert DOI]“.
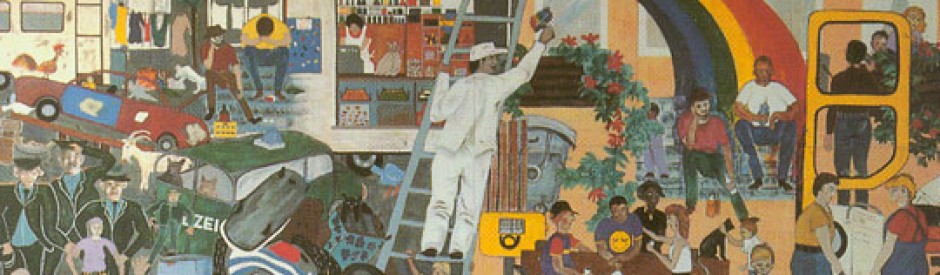
Bravo!