Ein Freund fragte mich neulich, welche Erfahrungen ich denn machen würde mit meinem Buch? Kommt deine Botschaft an? Wird sie aufgegriffen? Wird sie ernst genommen? Und führt sie dazu, dass KollegInnen einen anderen, neuen Blick auf ihre Praxis und überhaupt auf die Lage der Sozialen Arbeit bekommen?
Hier unser Gespräch:
Natürlich habe ich nicht erwartet, dass mein Buch zu explosionsartigen Veränderungen führen würde. Ich habe nicht einmal das erwartet, was ich vor 13 Jahren nach Veröffentlichung des Schwarzbuches erlebt habe, nämlich dass mich eine Zeit lang fast täglich neue Mails erreichten von PraktikerInnen, die sich freuten: “Endlich spricht einmal jemand das aus, was uns die ganze Zeit schon belastet und unsere Arbeit so sehr erschwert“. Schließlich hat sich in diesen Jahren einiges verändert und ich fürchte, dass der Neoliberalisierungsprozess inzwischen weit fortgeschritten ist- allerdings ohne, dass es von den meisten zur Kenntnis genommen wird.“
Wie haben SozialarbeiterInnen dieses Mal reagiert?
Etliche, vor allem KollegInnen, insbesondere KollegInnen meiner Generation haben mir geschrieben, dass sie es toll fänden, wie sehr ich mich für die Belange unserer Profession engagiere. Etliche haben angekündigt, Sie würden mir demnächst mehr schreiben, wenn sie das Buch gelesen hätten. Nur vereinzelt kam dann später noch eine Rückmeldung.
Von PraktikerInnen habe ich noch wenig gehört.
Wie erklärst du dir das?
Ich fürchte, das Buch ist ihnen einfach zu dick. Die meisten PraktikerInnen geben zu, dass sie zuletzt für ihren Bachelor oder die Masterarbeit Fachliteratur gelesen haben.
Ansonsten glaube ich, dass die Botschaften des Buches für die meisten LeserInnen einfach zu unangenehm und zu provozierend sind. Letztlich habe ich ja heftig Kritik an der derzeitigen Profession und an ihrer Lethargie, was die politischen Themen betrifft geübt. Wer kann es schon gut ertragen, wenn man kritisiert wird. Wahrscheinlich erwarten die LeserInnen eher entlastende Schuldzuschreibungen an irgendwelche externen Ursachen oder hoffnungsvolle, motivierende Ratschläge, wie man die Lage gut und einfach verbessern kann.
Ich laste die prekäre Entwicklung unserer Profession ja nicht den SozialarbeiterInnen selbst an, sondern zeige eigentlich sehr deutlich, wo die Schuldigen, wo die eigentlichen Hintergründe zu suchen sind. Aber gleichzeitig stelle ich klar, dass auf die Profession und ihre verschiedenen VertreterInnen die Verantwortung dafür zukommt, ob sie selbst diese Bedingungen problemlos hinnimmt, sich einfach anpasst oder aber im Interesse der Profession und der KlientInnen, für die sie zuständig ist, gegen diejenigen Entwicklungen Widerspruch und Widerstand leistet, die ihrer eigenen professionellen Ethik und Konzeption widersprechen.
Du erwartest vielleicht zu viel von den Menschen?
So scheint es mir. Wenn ich auf einer Tagung über meine Erkenntnisse und Schlussfolgerungen spreche, wenn ich versuche, KollegInnen meine Überlegungen nahezubringen, wenn ich sie darauf hinweise, dass sie sich in einer Weise verhalten, die die Soziale Arbeit gefährdet, dann erlebe ich immer wieder genau das Verhalten und die Reaktionen, die ich im Buch in den Kapiteln 10 bis 13 beschrieben habe, wo es darum geht, wie die Profession sich gegenüber der schleichenden, aber massiven neoliberalen Transformation verhält.
Weißt du, ich komme mir vor wie ein Kabarettist, einer der wirklich kritischen Sorte, der seinem Publikum harte Fakten vorstellt, aufwühlende Fakten und Fakten, von denen er sich wünschen würde, dass die Leute verändert aus seiner Vorstellung herauskommen. Aber er weiß es und lebt damit, dass sie klatschen, stolz darauf sind, dass sie es wagten, sich solch kritische und provokante Sachen anzuhören und sich angenehm entlastet fühlen dabei- dass sie aber anschließend den Saal verlassen und alles so weitermachen und auch weiter so denken, wie sie es auch vorher taten.
Das klingt nicht so gut. Wie hältst du das aus?
Ich habe vor kurzem auf einer Tagung eines Trägerverbandes ein Referat gehalten. Ich war angefragt, unbedingt etwas Kritisches, auch gerne Provozierendes zu sagen. Man hat höflich geklatscht, ein paar Verständnisfragen gestellt aber das wars. Im weiteren Verlauf der Tagung wurden meine Impulse nicht aufgegriffen, wenn ich nicht selbst dafür gesorgt habe. Und je länger diskutiert wurde, desto mehr ging es eigentlich nur noch darum, wie man es schaffen könne, auch unter den gegebenen, durch die herrschende Sozialpolitik gesetzten Rahmenbedingungen „das Beste daraus zu machen“, „die doch vorhandenen Nischen und Möglichkeiten auszunutzen“, „die Dinge in Angriff zu nehmen, die man in eigener Regie verändern könne und man zerbrach sich den Kopf darüber, wie man es gerne hätte, wo man hin wollte und glaubte, aus eigener Kraft die Bedingungen in der Praxis herstellen zu können, die man gerne haben würde.
Nur ein Beispiel:
Dass sich das Verhältnis zwischen freien Trägern und der öffentlichen Jugendhilfe und der Kommune aufgrund der bestehenden einseitigen Machtstruktur oft sehr angespannt gestaltet, wurde beklagt. Man fragte sich: Wie könnte man das ändern? Statt auf Konflikt setzte man auf Verständnis und Zusammenarbeit mit den VertreterInnen der öffentlichen Jugendhilfe und erhoffte sich ein Verhältnis auf Augenhöhe. Das sind edle Absichten, keine Frage und nicht die VertreterInnen der öffentlichen Jugendhilfe sind es schließlich, die ein solches Verhältnis nicht haben wollen. Dass aber schon allein die vom Staat verbindlich eingeführte Neue Steuerung genau dies verhindert und verhindern will, wurde dabei ausgeblendet. Man glaubte lieber daran, die bestehenden Widersprüche durch beidseitigen guten Willen und bessere Kommunikation ausräumen zu können.
Mein Appell, die bestehenden Widersprüche zwischen dem eigenen professionellen Konzept und dem neoliberalen Konzept der Sozialen Arbeit sowie deren Inkompatibilität zur Kenntnis zu nehmen und Strategien zu entwickeln, wie man diesen Widerspruch thematisieren könnte, um den Irrweg der Neoliberalisierung einer Profession infrage zu stellen, ist ganz offensichtlich verpufft. Die Aufforderung, sich zur Wehr zu setzen gegen die Umwandlung der subjektorientierten, humanistischen Unterstützung für sozial benachteiligte und belaste Menschen in eine effiziente Produktionsstätte der Ware Soziale Arbeit wurde beklatscht aber sofort wieder vergessen.
Und mit Hilfe der KI wurde den TeilnehmerInnen der Tagung als Ratschlag und Aufmunterung für ihre weitere Arbeit am Ende der Tagung Folgendes mit auf den Weg gegeben:
„Gleichzeitig möchte ich euch ermutigen, die Widersprüche auszuhalten, die ihr täglich erlebt – zwischen Qualitätsanspruch und Ressourcenknappheit, zwischen Autonomie der Familien und institutionellen Vorgaben. Diese Paradoxien sind nicht euer persönliches Versagen, sondern strukturelle Realität. Eure Aufgabe ist es nicht, sie aufzulösen, sondern in ihnen handlungsfähig zu bleiben und dabei auf euch selbst zu achten.“
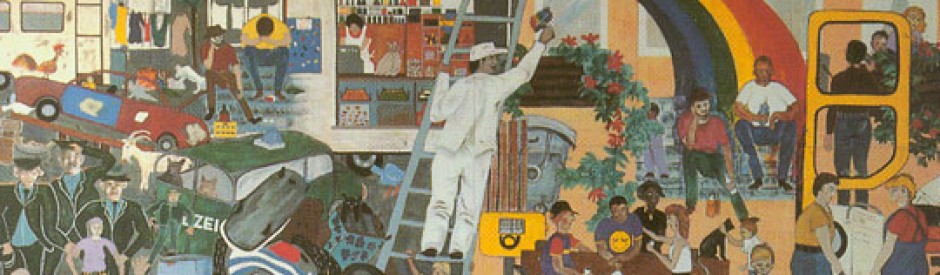
Liebe Ann-Christin Gericks, so macht dieser Beruf keine Freude, nicht wahr? Aber denoch bin ich erfreut, dass sie schreiben, dass…