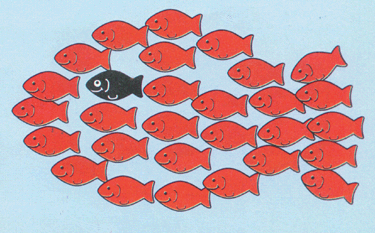Zur Zeit betreue ich ein Projekt , in dem sich Studierende an eine qualitative Untersuchung bei PraktikerInnen trauen zu der Frage, wie sich zu Zeiten von Ökonomisierung und aktivierendem Staat ihre Arbeitssituation konkret verändert hat. Man kann auf die Ergebnisse gespannt sein. Die Interviews liegen schon vor, die Auswertung kommt noch.
Was aber jetzt schon deutlich ist: SozialpädagogInnen, die im Kontext ARGE (in Jobcentern und Beratungsstellen) arbeiten und vor drei Jahren noch unter den beengten thematischen und methodischen strukturellen sowie ethisch problematischen Vorgaben des Fallmanagements gestöhnt haben und sich fragten, ob diese Tätigkeit wirklich eine sozialpädagogische Tätigkeit sei, die sie vor sich selber verantworten können, haben sich mit ihrer Situation inzwischen arrangiert und abgefunden, ja sie sehen inzwischen echte fachliche Möglichkeiten, wie sie als SozialpädagogInnen für ihre Klientel etwas erreichen können.
Na dann ist ja doch alles in Ordnung?
Frage ist nur: Haben sich die Bedingungen für professionelle und partizipative Arbeit in diesem Bereich und vielleicht auch speziell an der konkreten Arbeitsstelle wirklich zum Positiven entwickelt? Oder haben sich die KollegInnen nur einfach an den gesetzten Rahmen gewöhnt und versuchen nun, irgendwie doch das Beste daraus zu machen?
Ich fürchte, niemand hält drei Jahre lang aus, in dem Bewußtsein zu leben und zu arbeiten, dass an den Grundlagen der eigenen beruflichen Tätigkeit etwas faul ist. Entweder er geht – und wer kann sich das leisten – oder er wird krank. Oder er versucht eben doch aus Stroh Gold zu spinnen.
Ich frage mich, was man tun kann, damit kritische Studierende, die in der Praxis ankommen, eine Chance haben, sich ihr kritisches Bewusstsein zu erhalten und Wege zu finden, gemeinsam an den Grundlagen solcher Arbeitsbedingungen zu rütteln?