AutorInnen, die mich für mein Buch inspiriert haben(s. (Neuerscheinung: Soziale Arbeit und Neoliberalismus heute: schwarz auf weiß | SpringerLink)
Teil 8
Prof. Dr. Nikolaus Meyer und Elke Alsago

… die zeitnah und kritisch die Entwicklungen dokumentiert haben, die die Soziale Arbeit durch die von der Politik angeordneten Maßnahmen und Regelungen anlässlich der „Corona-Pandemie“ durchgemacht hat und die Bedingungenanalysiert haben, denen diese ausgesetzt war….

Ganz wichtig war für die Entwicklung meines Buches und meiner Überlegungen der Blick auf das, was mit der Sozialen Arbeit in aller jüngster Zeit passiert ist. Die Phase der „Corona-Pandemie“ stellt – so wie für die gesamte gesellschaftliche Entwicklung – auch für die Soziale Arbeit einen entscheidenden Einschnitt dar, der von vorneherein mit dem Narrativ durch die Medien beschworen wurde: „Nichts wird wieder so sein, wie es vorher war“.
Das hat sich für die Soziale Arbeit bestätigt, oder besser gesagt, die bestehenden Neoliberalisierungs- und Entprofessionalisierungstendenzen in der Profession bekamen aus dieser Zeit einen ganz neuen verschärften Anschub und brachten die Soziale Arbeit einen großen Schritt in Richtung einer neoliberalisierten Profession „voran“.
Das Buch „Prekäre Professionalität“ von Alsago und Meyer (2023) weist zum einen (S. 67) darauf hin, dass in der Corona-Phase „nur jenen Bereichen der Sozialen Arbeit Bedeutung zukam, die den Alltag von großen Menschengruppen bestimmten und mit wirtschaftlichen Interessen verknüpft waren (z. B. Kita oder hoheitliche Aufgaben (z. B. Jugendamt) betrafen. Alle anderen Aufgaben der Jugendhilfe wurden als nicht systemrelevant behandelt und vernachlässigt oder zurückgewiesen.
Was sich unter diesen politischen Rahmenbedingungen in der Profession verändert hat, wird bei den AutorInnen akribisch und für die ganze Breite der Sozialen Arbeit nachvollzogen. Besonders interessant ist das Ergebnis, dass gravierende Veränderungen im Kontext der personellen Begegnung zwischen SozialarbeiterIn und KlientIn beobachtet wurden, die auch heute noch nachwirken und aufrechterhalten werden.
So stellen die AutorInnen am Ende der Pandemie-Zeit ernüchtert fest: „Im November 2022 nahmen 81,3 % der Befragten Veränderungen in den eigenen Arbeitsschritten wahr, 55 % berichteten von veränderten Standards und Verfahren seit Ausbruch der Corona-pandemie und 63,9 % befürchteten, dass die jeweilige Einrichtung auch nicht mehr zu diesen (den früheren Standards; Anm. d. V.) zurückkehren würde“ (Alsago und Meyer 2023, S. 33).
Eine besondere Rolle für diese Entwicklung spielte nach Alsago und Meyer der verstärkte, explosionsartige Einsatz digitaler Medien. Auch wenn für die eigene Arbeitssituation der Einsatz der digitalen Medien von den SozialarbeiterInnen zum Teil als Erleichterung erlebt wurde, beurteilten die meisten der befragten SozialarbeiterInnen den verstärkten Einsatz digitaler Kommunikationsmittel im Hinblick auf die Kommunikation mit den KlientInnen sehr kritisch, da er eine deutliche Veränderung und Verschlechterung der Beziehungsarbeit mit sich brachte.
Alsago und Meyer begnügen sich nicht damit, dieses Ergebnis in den Raum zu stellen. Sie ziehen Schlussfolgerungen: Wenn man den Trend dieser Veränderungen in der Beziehung zwischen SozialarbeiterInnen und KlientInnen genauer betrachtet, weisen diese fast alle in eine ganz bestimmte Richtung: Es geht um weniger Empathie und um ein nur minimales Eingehen auf die Klientel. Die Vorgehensweisen haben mit Arbeitsbündnis und Beziehungsarbeit nichts mehr zu tun. Angestrebt werden mehr Distanz, weniger direkte Kontakte, die Einschränkung oder Abschaffung von Beziehungsarbeit und direkter Kommunikation, die Verunmöglichung von Einblicken in die Lebenswelt der Klientel sowie generell eine Einschränkung der Möglichkeit, sich auf menschlicher Ebene und ohne Amts- oder Diensthintergrund zu begegnen. Die Digitalisierung zusammen mit der entstandenen Angst vor Berührungen hat dafür gesorgt, dass diese fachlich anspruchsvollen und wesentlichen Handlungsprinzipien Sozialer Arbeit, insbesondere der direkte Kontakt mit der Klientel, in Corona-Zeiten aufgegeben wurde. Und: Nähe, Beziehungsarbeit, direkter Kontakt stehen heute noch immer im Verdacht, nicht wirklich professionell zu sein. Die Beobachtung von Alsago und Meyer (2023, S. 66) aus der Corona-Zeit, dass z. B. die zentralen Kernaktivitäten des Beratens, Begleitens und Vermittelns im Kontext sozialer Einrichtungen zu einer reinen Betreuung umdefiniert wurden, machen deutlich, wie leicht genau das passieren kann.
Angesichts dieser erschreckenden Erkenntnisse konstatieren Alsago und Meyer (2023, S. 68f): „Wo all diese Einschränkungen an Autonomie und veränderten Arbeitsweisen herrschen, müssten, wenn es um professionelle Strukturen innerhalb eines Berufes geht, die Mitglieder dieses (besonderen) Berufs auch vehement ihr Selbstverständnis vortragen. In der letzten Befragung einen Monat nach Ende der meisten Corona-Maßnahmen zeigten sich solche Tendenzen nicht. Hier dominierten stattdessen Erwartungen an die Träger bezüglich der Klärung der Situation.“
Dass viele dieser neuen Umgangs-Formen und viele der Einschränkungen nach Corona einfach beibehalten wurden, ist sehr bezeichnend. [1]
Alsago und Meyer kommt der Verdienst zu, die Corona-Erscheinungen in ihren politischen und sozialpolitischen Zusammenhängen zu zeigen und deutlich zu machen, was diese Entwicklung für weitere Folgen hat. Gab es noch während der Corona-Phase SozialarbeiterInnen, die sich der Illusion hingaben, dass es nach Beendigung der „Pandemie“ möglich sein würde, die Soziale Arbeit endlich wieder auf ihre sozialpädagogischen Füße zu stellen, da in der Pandemie-Phase überdeutlich geworden war, wohin die Fahrt mit unserer Profession ging, so machen Alsago und Meyer anhand ihrer ausführlichen Recherchen und Befragungen in aller Klarheit deutlich, dass mit einer solchen Veränderung nicht zu rechnen ist, dass vielmehr die Corona-Phase dazu geführt hat, dass sich deprofessionalisierende und entpädagogisierende Prozesse und Verfahren, die in dieser Phase entstanden sind und einfach – ohne Not – beibehalten wurden, immer weiter verstetigt haben und weiter verstetigen.
Literatur:
Alsago, E./Meyer, N. (2023): Prekäre Professionalität. Soziale Arbeit und die Corona-Pandemie. Opladen: Barbra Budrich.
[1] Anmerkung Seithe: Man könnte auf den Gedanken kommen, dass hier offenbar eine gesellschaftlich verordnete, politische Situation dazu genutzt wurde, der Profession Soziale Arbeit angestrebte und bisher nur schleppend umgesetzte Veränderungen näher zu bringen, indem sie einfach durch Vorschriften eingeführt und damit als normal und selbstverständlich markiert wurden. Denn die sich hier abzeichnenden Tendenzen weisen darauf hin, dass sich in der Praxis vieles in eine Richtung bewegt, die mit den Folgen der Neoliberalisierung korrespondiert.
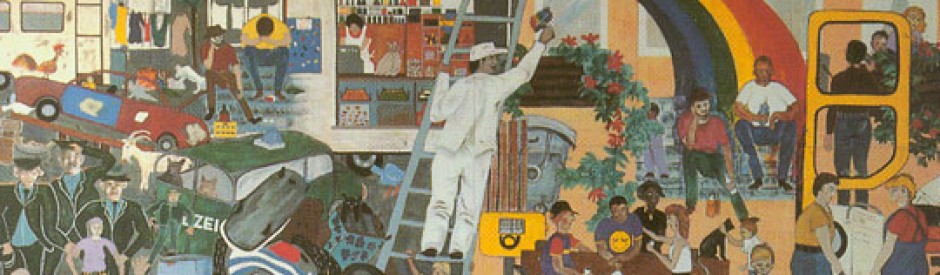
Bravo!