„Wir Sozialarbeitenden sind Teil des Problems geworden, wenn wir schweigen. Die Instrumentalisierung der Sozialen Arbeit funktioniert nur, weil wir sie zulassen.„
Die saarländische Ministerin für Soziales sagte 2017 einmal zu mir: Frau Seithe, da sind Sie ja wohl die Einzige, die die Lage der Sozialen Arbeit so kritisch sieht.“ Es war die Zeit, in der wir gemeinsam gegen die neoliberale „Reform“ des Kinder- und Jugendhilfegesetzes kämpften.
Manchmal denke ich, dass diese Frau Recht hatte, manchmal befürchte ich es. Aber das ist nicht so.
Mich erreichte folgender Gastbeitrag :
Erfahrungen aus dem Kinderschutz
Ein Zeitungsartikel in der Berliner Morgenpost – Überlastete Jugendämter in Berlin-
„uns fehlt die Zeit“ vom 07.07.2025 brachte sie zurück: meine längst verdrängten
Erinnerungen an die Zeit als Sozialarbeiterin im Kinderschutz. Was ich dort las, war
erschreckend vertraut – und genau das ist das Problem.
Nach vielen Jahren bin ich gelinde gesagt erschüttert:
Die Klagen und Forderungen der Kolleginnen und Kollegen im Regional Sozialpädagogischen Dienst (RSD) sind unverändert dieselben wie vor zwei Jahrzehnten.
Bereits 2004 gingen Fachkräfte mit identischen Themen und Forderungen auf die Straße. Heute kämpfen Sozialarbeitende im RSD immer noch gegen die gleichen strukturellen Probleme.
Ich habe wenig Hoffnung, dass sich etwas zugunsten der Jugendhilfe positiv verändern
wird. Und das liegt nicht nur an fehlenden Ressourcen – es liegt u.a. an einem System,
dem es nicht gelingt, die Bedarfe der Jugendhilfe thematisch und politisch nachhaltig
zu platzieren.
Die Aussage der zuständigen Senatsverwaltung für Jugend, Fachkräfte hätten nichts zu
befürchten, wenn sie sich öffentlich zu ihren Arbeitsbedingungen äußern, ist kaum
glaubwürdig. Wäre sie zutreffend, gäbe es längst einen konstruktiven und offenen
fachlichen Austausch: Sozialarbeitende in Jugendämtern sowie bei ambulanten und
stationären Trägern der freien Jugendhilfe würden offen über Missstände in der
Jugendhilfe und ihre Arbeitsbedingungen diskutieren.
Die Realität zeigt ein anderes Bild: Viele Kolleginnen und Kollegen scheuen sich, ihre
fachliche und persönliche Meinung zu äußern. Eine Kultur des Schweigens und der
Resignation dominiert, geprägt von der – nicht unbegründeten – Sorge um die
berufliche Existenz.
Was systematisch verschwiegen wird, sind die dramatischen Auswirkungen auf die Betroffenen: Viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene können in der
Jugendhilfe nicht mehr adäquat untergebracht oder versorgt werden. In
Krisensituationen müssen sie mangels geeigneter Plätze in weniger oder ungeeigneten
Einrichtungen untergebracht werden. Gelegentlich werden sie trotz bestehender
Gefährdungseinschätzung weggeschickt, weil keine Krisenplätze zur Verfügung stehen.
Dabei wird billigend in Kauf genommen, dass Kinder und Jugendliche in emotional
herausfordernden Ausnahmesituationen auch in stationären Einrichtungen nicht den
notwendigen Schutzraum bekommen. Die für eine stabilisierende und haltgebende
emotionale Entlastung erforderliche Betreuungskontinuität kann von vielen
Kriseneinrichtungen kaum noch gewährleistet werden.
Neben dem Fachkräftemangel spielen weitere Faktoren eine Rolle: hohe
Arbeitsbelastungen, unzureichende Qualifizierung für die Arbeit mit herausfordernden
Kindern und Jugendlichen, schlechte Bezahlung, mangelnde Wertschätzung von
Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen etc.
Man gewinnt den Eindruck, dass die politisch Verantwortlichen sich mit den
Bedingungen in der Jugendhilfe nicht (lösungsorientiert) auseinandersetzen möchten.
Anstatt die Arbeitsbedingungen für Beschäftigte zu verbessern und förderliche
Rahmenbedingungen für erfolgreiche Betreuungsverläufe zu schaffen, wird derzeit über
geschlossene Einrichtungen für betreuungsintensive Kinder und Jugendliche diskutiert.
Intensivpädagogische Betreuungsangebote benötigen jedoch eine solide fachliche und
personelle Ausstattung. Einsparungen bei der Personalausstattung erweisen sich
langfristig als kontraproduktiv und verursachen höhere Folgekosten.
Nicht die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind das Problem. Das
Problem ist ein System, das versagt – und dann die Opfer dieses Versagens
wegschließen will.
Über all diese Themen wird nicht gesprochen. Sie werden unter den Teppich gekehrt – nicht nur im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.
Die Soziale Arbeit läuft Gefahr, ihre professionelle Unabhängigkeit zu verlieren. Zunehmend lässt sie sich von Arbeitgebern, Institutionen und Verwaltungsapparaten
vereinnahmen. Anstatt selbstbewusst auf ihre fachlichen Standards und ethischen
Grundsätze zu setzen, unterwirft sie sich externen Vorgaben – vermeintlich, um ihre
Existenzberechtigung zu sichern.
Es gibt kein berufliches Selbstbewusstsein, für den eigenen Berufsstand und die Rechte
der Klientel einzustehen. Vielmehr tragen auch wir Sozialarbeitenden dazu bei, dass
unsere Klientel mit ihren Sorgen und Nöten vielerorts (größtenteils) allein gelassen
wird: Die sogenannte „Professionalisierung“ der Sozialen Arbeit entfernt sich zunehmend von der Beziehungsarbeit – dem Kern unserer Tätigkeit. Es geht nicht mehr um Menschen, sondern um Fallzahlen, Kostensenkung und Effizienz.
Für mich stellt sich die zentrale Frage: Kann Soziale Arbeit unter
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten im Abhängigkeitsverhältnis zu ihren
Geldgebern solidarisch und engagiert für die Rechte ihrer Klientel einstehen?
Das Ergebnis ist ernüchternd: Die Not von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen wird zunehmend zur Ware. Träger unterbieten sich gegenseitig bei
Personal-, Sach- und Fachleistungskosten, um Aufträge in der Jugendhilfe zu erhalten.
Diese Praxis führt dazu, dass Hilfeverläufe teilweise erhebliche negative Auswirkungen
auf die Entwicklung der Klienten haben – nicht trotz, sondern gerade wegen der
Systemlogik.
Das geringe berufspolitische Engagement von vielen Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeitern spiegelt eine weitverbreitete gesellschaftliche Entwicklung wider. Um
eine selbstkritische Auseinandersetzung mit dieser Thematik anzustoßen, braucht es
Unterstützende auf verschiedenen Ebenen.
Neben den Hochschulen sind auch politische Akteure gefragt, die die Profession
stärken.
Erfolgreiche Soziale Arbeit setzt wirtschaftliche Autonomie voraus, damit Fachkräfte
ihre professionelle Expertise ohne finanzielle Zwänge oder externe Interessenskonflikte
voll ausschöpfen können.
Die Lösung liegt nicht in kosmetischen Korrekturen oder neuen Gesetzen, die alte
Probleme umbenennen.
Nötig sind:
* Strukturelle Unabhängigkeit: Die Soziale Arbeit benötigt größere finanzielle Autonomie gegenüber ihren Geldgebern. Erforderlich sind verlässliche Budgets, über die Sozialarbeitende eigenverantwortlich und bedarfsorientiert verfügen können, ohne permanenten Rechtfertigungsdruck.
* Besinnung auf die Profession: Zurück zur Beziehungsarbeit, weg von der reinen Verwaltung von Notlagen.
* Berufspolitisches Engagement: Fachkräfte müssen wieder lernen, für ihre Profession
und ihre Klientel einzustehen.
* Ehrliche Diskussion: Schluss mit dem Verschweigen und Vertuschen – auch wenn es unbequem wird.
* Schutz für kritische Stimmen: Wer Missstände benennt, darf nicht um seinen Job
fürchten müssen.
Nach Jahren im System bin ich zu dem Schluss gekommen:
Wir Sozialarbeitenden sind Teil des Problems geworden, wenn wir schweigen. Die Instrumentalisierung der Sozialen Arbeit funktioniert nur, weil wir sie zulassen.
Es ist Zeit, unbequeme Wahrheiten auszusprechen: Das System versagt nicht – es
funktioniert genauso, wie es funktionieren soll. Billig, oberflächlich und ohne echte
Verantwortung für die Folgen.
Die Kinder und Jugendlichen, um die es eigentlich gehen sollte, sind dabei nur noch
Kostenfaktoren in einer Gleichung, die nicht aufgeht. Das muss sich ändern – nicht in 20
Jahren, sondern jetzt.
Wenn Sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder machen, teilen Sie sie. Nur durch
Öffentlichkeit kann sich etwas bewegen.
Schweigen ist keine Lösung und muss daher aufgebrochen werden.
(Der Name der Gastautorin ist der Redaktion bekannt.)
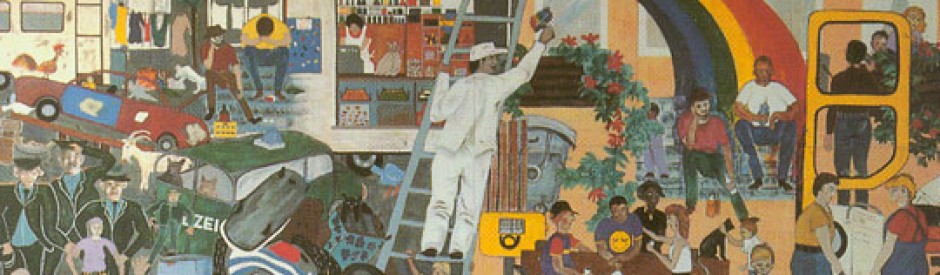
Bravo!