

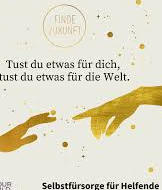
Selbstfürsorge seht hoch im Kurs. PraktikerInnen reißen sich um entsprechende Fortbildungen und Weiterbildungen. Die Lehre und die Wissenschaft hält die Selbstfürsorge für ein probates und wichtiges Rezept, um die Strapazen und Herausforderungen der Praxis gut zu überstehen.
Dass die Soziale Arbeit einer der Berufsbereiche mit der höchsten burnout-Quote ist, ist hinlänglich bekannt. Befragungen ergaben und ergeben immer wieder und mehr denn je, dass die KollegInnen den Beruf der SozialarbeiterIn als sehr belastend und anstrengend erleben. In meiner Befragung von 109 SozialarbeiterInnen als allen nur möglichen Arbeitsfeldern waren % der Meinung, dass sie diesen Beruf deshalb wohl kaum bis zur ihrer Rente durchhalten können.
Die meisten VertreterInnen der Disziplin, die sich mit der angespannten Lage in der Praxis befassen, stellen Anregungen im Sinne von Resilienz und Selbstsorge in den Mittelpunkt ihrer Empfehlungen. Es geht ihnen darum, die bestehenden Belastungen auf individuelle und psychologische Weise zu reduzieren. Die professionelle Selbstfürsorge soll die vorhandenen und belastenden Widersprüche für den Einzelnen erträglich machen. Die so oft empfohlene „professionelle Selbstfürsorge“ erweckt die Illusion, die vorhandenen Probleme und Widersprüche selbst lösen zu können und verwischt auf diese Weise die wirklichen Hintergründe.
Ein typisches Beispiel: Abstrakt für ein Online-Seminar zum Thema: „Selbstfürsorge in der Sozialen Arbeit – gerade in Krisenzeiten (Katrin Liel 2021): „Sozialarbeiter:innen üben einen anspruchsvollen und herausfordernden Beruf aus. Sie sind darüber hinaus – wie alle Beschäftigten – den Anforderungen der Digitalisierung sowie der Beschleunigung und Verdichtung von Arbeitsprozessen ausgesetzt. Diese Prozesse wurden und werden durch die Corona-Pandemie nun noch intensiviert und verschärft. Die Gesundheitsförderung von Fachkräften und die Prävention von Burnout sind hierbei eine große Herausforderung. Eine Online-Seminarreihe der Deutschen Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen (DVSG) hat aus diesem Grund das Thema „Selbstfürsorge für psychosoziale Fachkräfte – gerade in Krisenzeiten“ aufgegriffen.
Die Selbstfürsorge ist die derzeitige verbreitete und als einzig hilfreich verstandene Antwort auf die Problemlagen, die in der Praxis erfahren werden. Es ist sicher nichts dagegen zu sagen, wenn man vorsichtig und klug mit seinen Kräften umgeht und sich als Person nicht verschleißen lässt. Aber als Antwort auf das, was hinter den Problemlagen und Herausforderungen steht, ist es doch ziemlich dünn.
Ein exemplarisches Beispiel aus einer Bachelorarbeit (Kleinwechter (2017), das ich in meinem Buch aufgegriffen habe, macht deutlich, dass sogar da, wo der neoliberale Zusammenhang von Konflikten und Belastungen durchaus klar erkannt wird, diese dennoch auf die gleiche, psychologisch-individuelle Weise „bekämpft“ werden sollen: Kleinwechter stellt in ihrer Bachelorarbeit die Problematik der Sozialarbeitenden unter den neoliberalen Bedingungen in aller Schärfe dar. Dann aber kommt sie zu dem Schluss: „Folglich sollte Selbstsorge ein integraler Bestandteil beruflicher Identität werden.“ ( S. 41). Hier werden die politischen Gründe für die massiven Belastungen zwar erkannt. Dennoch bleibt die Vorstellung darüber, was an Lösungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen könnte, auf die Selbstfürsorge beschränkt.
Somit wird in den meisten Fällen, auch wenn es um Belastungen geht, die offensichtlich durch die neoliberalen Zumutungen entstehen, die Lösung des Problems bei den SozialarbeiterInnen selbst gesucht, die sich dann – logischerweise – nach den Selbstfürsorgemethoden umschauen. Schaut man genauer hin, so hat der Selbstfürsorge-Boom, der derzeit unter PraktikerInnen herrscht, eine fatale Nähe zum Aktivierenden Staat und seiner Absicht, Menschen für gesellschaftliche Probleme allein verantwortlich zu machen.
Und sie entspricht genau auch dem, was von der Sozialen Arbeit heute in ihrer Haltung gegenüber den Problemlagen der Klientel erwartet wird. So ist Armut heute nicht mehr ein gesellschaftliches Problem, für das die Gesellschaft verantwortlich zeichnet und Lösungen zu bringen hat. Vielmehr geht es nur noch darum, zu schauen, dass die Klienten lernen, mit ihrer Armut besser und so umzugehen, dass sie sie ertragen können.
Nichts anderes ist die Aufforderung der MitarbeiterInnen zur Selbstfürsorge angesichts der massiven Belastungen durch Arbeitsverdichtung, Sparmaßnahmen und Effizienzdogmen: So gesehen versucht hier die Praxis selbst und mit ihr zusammen die Disziplin, die Probleme, die von der neoliberalen Transformation der Sozialen Arbeit herrühren, mit Mitteln und Strategien genau dieser neoliberalen Konzeption zu bekämpfen. Aus Sicht des Neoliberalismus ist das ein ‚Volltreffer‘.
Und das ist nur einer der beiden Aspekte, die die Selbstfürsorge in ihrer zentralen Bedeutung problematisch macht:
Nicht nur, dass die Betroffenen sich bereitwillig der Aufgabe unterziehen, Probleme, die sie selbst nicht zu verantworten haben, dennoch auf ihre Schultern zu nehmen und individuell zu lösen- mit dieser Bereitschaft ist auch verbunden, dass die Probleme als gegeben, als unabwendbar und unvermeidbar hingenommen werden und über ihre Ursachen, ihre Hintergründe, über möglich Interessen derer, die diese problematischen Verhältnisse herstellen und durchsetzen nicht nachgedacht wird.
- So schafft der Neoliberalismus nicht nur Individuen, die bereitwillig ihre schwierige Lage selbst auf sich nehmen und für ihre alleinige Verantwortung halten, er schafft vor allem „Wahrheiten“, die als unumstößlich hingenommen, akzeptiert und sogar verteidigt werden gegen die, die sie wagen zu kritisieren.
- Dies ist als gesellschaftliches Phänomen keineswegs auf die Soziale Arbeit beschränkt.
- Genau so wird die Bevölkerung insgesamt heute dazu gebracht, sich angesichts von Bedrohungen, die man ihnen vorspielt und von morgens bis abends durch die Medien verbreiten lässt, nur noch damit zu befassen, wie man diese Bedrohungen am besten aushält und daran nicht zugrunde geht. Ob diese Bedrohung tatsächlich existiert, wird nicht hinterfragt, wer für sie verantwortlich zeichnet, wer davon profitiert, all diese Fragen stehen überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Man nimmt sie als Fakt, schluckt sie als „Wahrheiten“ und versucht trotzdem möglichst gut für sich und sein Wohlergehen und Überleben zu sorgen.
- Wenn wir da mitspielen, tragen wir zur Stabilisierung der neoliberalen Bedingungen in doppelter Weise bei.
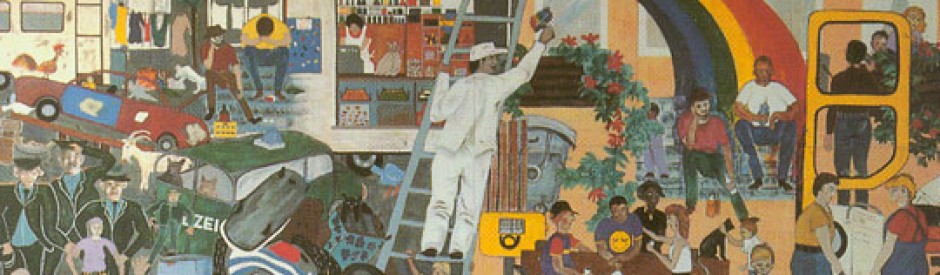
Bravo!