Bei einem Vortrag über mein neues Buch wurde mir die Frage gestellt, welche Rolle eigentlich die Träger im Prozess der Transformation der Sozialen Arbeit einnehmen und ob von ihnen etwas erwartet werden kann, was dieser Transformation Widerstand entgegensetzt.

Es war aufgefallen, dass ich bei der Frage danach, wer etwas bewirken und tun könne in Richtung Widerstand gegen eine fortschreitende Neoliberalisierung, die Träger kaum erwähnt habe. Das ist durchaus richtig beobachtet. Von den Trägern erwarte ich am wenigsten, und das hat seine Gründe:
Die freien Träger sind durch die Neue Steuerung in eine grundsätzlich neue Rolle geraten: Sie sind nur mehr abhängige Dienstleister.
In meinem Buch erkläre ich die Situation folgendermaßen:
„Zum einen entwickelte sich ihr Status zu dem eines „reinen Leistungsträgers“, der vom Gewährleistungsträger dominiert und zur Einhaltung der von ihm diktierten betriebswirtschaftlichen Verfahrensweisen gezwungen wird. … Es entstand ein neues Verständnis von „Subsidiarität“, in welchem die Anbieter sozialer Dienstleistungen zu unselbstständigen Akteuren wurden, die allein in ihrer Funktion zur Erbringung sozialer Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.
Der einzelne Träger steht, wenn es um die Frage geht, wer den Zuspruch für ein Projekt oder eine bestimmte Aufgabe erhält, in Konkurrenz zu anderen Anbietern, die ebenfalls ihre Ware verkaufen, und die von daher ein Interesse daran haben müssen, ihre Ware möglichst günstig anzubieten und möglichst noch günstiger zu produzieren.
Unter dem Primat der Effizienz und unter den Bedingungen des sozialen Pseudomarktes sind dabei fachliche Belange von sekundärer Natur und werden von den Erfordernissen des Überlebens der Träger auf dem Markt mehr und mehr an den Rand gedrängt.“
Galuske bemerkte schon vor Jahren (2002, S. 328): „Wo früher über Kinder und Jugendliche nachgedacht wurde, werden jetzt der Kunde hofiert, der Markt analysiert, Werbung betrieben, Konkurrenz beobachtet, Kosten gesenkt usw.“
Gleichzeitig – parallel zu ihrer Rolle als abhängige Dienstleistende – kommen die erbringenden Träger zwangsläufig in die Rolle von Unternehmern, die ihre „Produkte“ am Markt anbieten müssen. Als Unternehmer müssen sie jetzt ein unternehmerisches Risiko tragen. Laut Hagn (2017, S. 83) sind die meisten Träger der Sozialen Arbeit inzwischen „wirtschaftliche Unternehmen geworden, die unter dem Druck der bedingungslosen Effizienz und permanenter Kostenersparnis stehen“. Ihre „Betriebe“ müssen sich rechnen. Deshalb können sie nur da investieren, wo es sich finanziell lohnt. Der Gewinn (bei gewerblichen Trägern) und der Überschuss bei den freien Trägern stehen im Mittelpunkt des Interesses. Es geht tendenziell nur noch um Geld.
„Das alles hat Folgen für die MitarbeiterInnen, die bei diesen „sozialen Betrieben“ arbeiten:
Diese sehen sich gezwungen, sich mit der Lage ihres Arbeitgebers zu identifizieren. Gerade auch große und etablierte Unternehmen erwarten von den MitarbeiterInnen totale Loyalität. Kleinere Träger kämpfen um ihre Existenz und die MitarbeiterInnen müssen schon deshalb bei diesem „Konkurrenzkampf“ mitmachen und tun es auch, weil auch ihre eigene Existenz daran hängt.„
Das hat nach Hagn (2017, S. 89) außerdem enorme Konsequenzen für die Soziale Arbeit selbst: Der Zwang, möglichst kostengünstig und mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit arbeiten zu müssen, führt bei den Trägern dazu, dass für sie ein „creaming the poor“[1] sinnvoll ist. „So erscheint es wirtschaftlich rational, sich auf die einfachen und ‚erfolgversprechenden Fälle‘ als Adressaten zu konzentrieren und die ‚schwierigen und hoffnungslosen Fälle‘ auszugrenzen. Werden die – politisch gewollt verknappten – Mittel nach Erfolgsaussichten differenziert eingesetzt, dann wird auch Soziale Arbeit ‚investiv‘ und das heißt auch ‚selektierend und exkludierend ausgerichtet‘. “
„Ein großes Anliegen der vom Wohlwollen des Kostenträgers Staat abhängigen Träger ist es, für die Geldgeber möglichst sichtbar zu sein und als möglichst wirksam zu erscheinen. Die Träger sind sehr darum bemüht, sich nach außen zu zeigen, sich z. B. dem Amt, dem Geldgeber in Erinnerung zu bringen, sich als Träger im Gespräch zu halten. Folglich wird es als Aufgabe der MitarbeiterInnen gesehen, dass sie sich z. B. vor dem Amt präsentieren. „
Bei der Vergabe von Fällen und Aufträgen spielen laut Hagn (2017, S. 85) inhaltliche, fachliche Aspekte „nur noch eine untergeordnete Rolle. Infolgedessen sind es oftmals die Kosten einer Dienstleistung, die für die Finanzierungsträger, allen voran die Kommunalverwaltungen, im Fokus stehen.“ Wer das günstigste Angebot macht, also die größte Aussicht auf Effizienz verspricht, bekommt den Zuschlag. Das dabei viele Einrichtungen die Forderungen und benannten Ziele nur verbal bedienen, sie aber nicht in ihre Prozesse integrieren, scheint wenig zu stören.
Die Träger sind also in einem sehr direkten und existentiellen Maße in die neoliberalen Strukturen eingebunden. Für sie ist ein Aufbegehren gegen die Neue Steuerung und ihre Regelungen ein sehr hohes Risiko. Sie sind in ihrer Abhängigkeit gezwungen dem betriebsweirtschaftlichen Leitbild zu folgen. Hagn (2017, S. 86)
Eine besonders für die Gesamtstruktur der Sozialen Arbeit problematische Folge der Tatsache, dass freie Träger in die Rolle des Unternehmers gedrängt werden, sieht Hagn (2017, S.86) darin, dass das betriebswirtschaftliche Leitbild die bestehenden, traditionellen Leitbilder von Solidarität und Subsidiarität verdrängen. Das hat zur Folge, dass die „freie Wohlfahrt ihren Status als „Dritter Sozialpartner“ verliert, der auf Basis seines Expertenwissens in die Problemdefinition einbezogen wird und dabei Klienteninteressen advokatorisch vertreten kann“.
„Dies kann erklären, warum von Seiten der Wohlfahrtsverbände und der Träger Sozialer Arbeit bis auf Ausnahmen (vgl. z. B. Wendt, P.-U. 2022, S, 141ff) kaum offene und grundsätzliche Kritik an den neuen Verhältnissen erfolgt und auch nicht erwartet werden kann.“
Andererseits: Es gibt gerade in diesen Tagen zum Beispiel in Berlin eine große Demonstration gegen die Sparpläne des Senates, zu der Träger der Sozialen Arbeit aufgerufen haben und für die sie ihre Mitarbeiter freistellen. Und unter diesen Umständen kommen mit einem Mal tausende SozialarbeiterInnen auf die Straße – was bei Demonstrationen, zu denen „nur“ von den Gewerkschaften, dem Berufsversband etc. aufgerufen wird, nicht im Ansatz der Fall ist.
Wenn es den Trägern wirklich an den Kragen geht, scheint sich eine Interessengleichheit mit den MitarbeiterInnen herauszubilden.
Ich denke aber, solange die Träger nur um mehr Geld „betteln“ und nicht die Ursachen der unangemessenen und gefährlichen Sparmaßnahmen anklagen, wird sich auch durch solche Koalitionen nichts an der Ist-Situation ändern.
Es gibt hier und da aber auch Stimmen in der Trägerlandschaft, die sich nicht nur gegen die finanzielle Unterversorgung wehren, sondern die auch die zunehmende Verschlechterung der professionellen, sozialpädagogischen Qualität in der neoliberalen Sozialen Arbeit kritisieren (z.B. der Paritätische Wohlfahrtsverband oder der VPK (Bundesverband privater Träger der freien Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe e.V.).
Aber auch hier gilt: Sie werden nur dann etwas erreichen, wenn sie mit ihren Forderungen gleichzeitig klarstellen, dass der Grundansatz der neoliberalen Sozialpolitik (also die Vereinnahmung der Sozialen Arbeit in die Warenideologie, was sich durch die betriebswirtschaftliche Steuerung und die Durchsetzung des ideologischen Konzeptes des Aktivierenden Staates) der professionellen Sozialen Arbeit, ihrer Klientel und der Gesellschaft insgesamt schadet und warum und wenn sie auf einer Wiederherstellung und Wiederbelebung der sozialpädagogisch, humanistisch und ethisch definierten Sozialen Arbeit bestehen.
Aber es wäre Einiges möglich: Wenn sich alle Träger gemeinsam weigern würden, die Rollen des abhängigen Dienstleisters und des Unternehmers zu übernehmen, könnte sich durchaus etwas bewegen. Denn ohne die Erbringung ihrer Leistungen könnte der Staat seine vom Gesetz festgeschriebenen Aufgaben im Sozialbereich nicht erfüllen.
Also auch hier: Gemeinsam wären sie stark.
[1] „Creaming poor“ bedeutet die „Bestauslese unter den schon bereits schlecht Gestellten“.
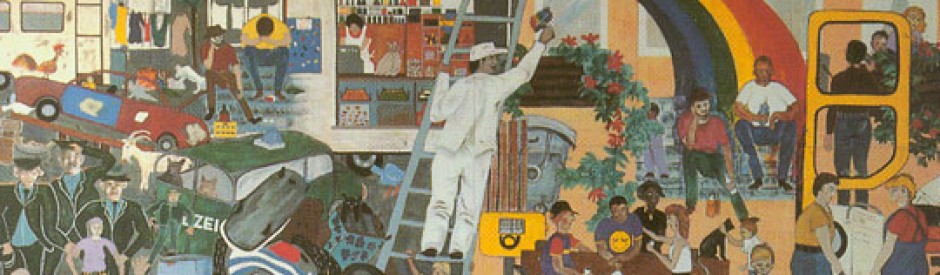
Bravo!