Beispiel 14:
Qualitätsmanagementversuche, die sozialpädagogische Leistung durch standardisierte Dokumentationsverfahren zu erfassen, sind sinnlos und führen letztlich zur Vernachlässigung von Qualität.
Eine Sozialpädagogin (33 Jahre alt, 5 Jahre Berufserfahrung in der Sozialpädagogischen Familienhilfe) berichtet von einem Experiment:
„Ich muss neuerdings für meinen Träger nach jedem Termin mit einer Familie einen Kontrollbogen ausfüllen, der meine Tätigkeiten in Bezug auf die im Hilfeplan genannten Ziele und die entsprechenden Zeiträume, in denen ich mich mit dieser Zielthematik beschäftigt habe, genau festhält. Zum Beispiel geht es dann um die Zeit von 14.30 bis 16.00, also um 1,5 Stunden. Der Kontrollbogen sieht vor, dass für jedes angesprochene Ziel einzeln mit Minutengenauigkeit der Zeitraum der Bearbeitung angegeben wird – quittiert von der Mutter, so als handele es sich um eine Handwerkerdienstleistung. Das sieht an einem bestimmten Tag dann in etwa so aus:
| Vertrauensaufbau | 15 Minuten |
| Mutter soll früh genug aufstehen | 15 Minuten |
| Mutter soll dem Kind Pantoffeln mitgeben | 28 Minuten |
| In Deutschland gelten bezgl. Pantoffeln andere Regeln | 2 Minuten |
| Die Mutter soll sich öffnenPlanung | 12 Minuten18 Minuten |
Das Ausfüllen und Übertragen ist aus meiner Sicht schlicht für die Katz. Denn alles kann in den 1,5 Stunden passiert sein. Der Bogen verrät es nicht: Gutes oder Schlechtes, viel oder wenig, fachlich Qualifiziertes und auch Stümperhaftes … Der Träger kann an den Eintragungen bestenfalls erkennen, dass hier jemand 1,5 Stunden bei der Familie war. Wie gearbeitet wurde, welche sozialpädagogische Qualität diese Arbeit hatte, das erschließt sich mitnichten. Nur Mühe macht der Bogen und frisst Zeit.
Was also wirklich in den 1,5 Stunden passiert ist und wie gut dort gearbeitet wurde, das ist so nicht zu erfassen. Das kann man auch nicht messen oder durch irgendwelche formalen Vorschriften oder Kriterien beschreiben.
Ich ärgere mich jedes Mal über dieses mangelnde Vertrauen in meine Fachlichkeit. Deshalb habe ich mir mal den Spaß erlaubt, als Anlage an so ein Kontrollblatt drei verschiedene und unter fachlichen Gesichtspunkten mehr als unterschiedlich zu bewertende Beschreibungen meiner vermeintlichen Tätigkeit anzuhängen. Wohlbemerkt: Alle drei Protokolle wären durch die Angaben auf dem Kontrollblatt völlig abgedeckt und den Tatsachen entsprechend festgehalten worden.
Variante 1:
Heute sind wir nicht dazu gekommen, in Ruhe zu sprechen. Ständig ging das Telefon oder jemand kam zu Besuch. Dazu lief wie immer der Fernseher. Ich habe die Zeit überbrückt und mit den Kindern ein bisschen im Kinderzimmer gespielt. Schließlich war die Zeit fast rum, als endlich niemand mehr störte und wir noch einmal kurz über das Kindergartenproblem sprechen konnten.
Sie meinte, es ginge eigentlich inzwischen ganz gut. Sie hätte ja jetzt den Wecker immer eingestellt. Ich könnte ruhig im Kindergarten nachfragen.
Wir haben vor, beim nächsten Mal über ihre Finanzsituation zu sprechen.
Variante 2:
Heute gab es wieder Ärger in der Kita. Man hatte mich bereits informiert. Die Kleine hatte mal wieder die Pantoffeln nicht dabei und die Erzieherinnen sind genervt, weil die Mutter das einfach nicht kapiert.
Ich habe Frau J. noch einmal eindringlich eingeschärft, dass sie die Pantoffeln mitgeben soll. Sie will nicht, weil sie es von zu Hause nicht kennt. Aber ich habe ihr klar gemacht: Wenn sie sich integrieren will und nicht unangenehm auffallen möchte als Ausländerin, dann muss sie sich einfach mal an unsere Regeln halten.
Die Gespräche mit Frau J. liefen wie immer ziemlich zäh. Sie will sich nicht öffnen und gleichzeitig spüre ich genau, dass sie sich gegen das sperrt, was ich von ihr erwarte. Die Liste, in der Frau J. täglich eintragen soll, ob sie es geschafft hat, rechtzeitig aufzustehen, war nur sporadisch ausgefüllt. Dabei hatte sie sich doch sogar schriftlich bereit erklärt hat, ihre Langschläferei aufzugeben.
Ich werde, das habe ich ihr jetzt angeboten, jeden Tag einmal kurz durchrufen, und fragen, ob sie rechtzeitig im Kindergarten war.
Variante 3:
Ich traf Frau J. heute in schierer Verzweiflung an. Sie erzählte mir, dass die Erzieherin sie heute früh wieder angemeckert habe, weil ihre Tochter keine Pantoffeln dabei hatte.
Wir haben in Ruhe darüber gesprochen, wie mies sie sich fühlt, wenn sie in den Kindergarten gehen muss, weil sie den Eindruck hat, dass die Erzieherinnen sie nicht mögen. Wir haben überlegt, was sie machen kann, damit sich das ändert. Sie bat mich, doch einmal für sie mit den ErzieherInnen zu sprechen. Ich habe versucht, mit ihr über ihre Angst und ihre Scham zu sprechen, der sie sich in diesen Situationen ausgesetzt sieht.
Frau J. wurde sehr gesprächig und erzählte viele andere Situationen aus ihrem Leben und dass sie sich sehr oft von anderen schlecht behandelt fühlt. Wir haben überlegt, ob es dafür Gründe geben könnte, die ihr einfallen.
Sie glaubt, die anderen sähen in ihr die kleine dumme Jessica, so wie ihre Mutter es tat. Wir haben überlegt, was sie tun kann, damit die ErzieherInnen merken, dass sie nicht die kleine dumme Jessica ist. Dabei ging ihr auf, dass sie selbst für sich sorgen muss und es nichts bringen würde, wenn ich mit den Erzieherinnen über sie spräche.
Wir haben geplant, nächste Woche die Tochter zusammen abzuholen. Dabei will sie die Erzieherinnen – mutig und ohne deren Blicken auszuweichen – fragen, wozu das Kind überhaupt Pantoffeln braucht. In ihrer Heimat gehen alle im Haus ohne Schuhe und das kennt die Kleine auch nicht anderes. Wir haben die Situation sogar einmal geübt und dabei konnte sie schon wieder lachen, weil wir uns die Verblüffung der Erzieherinnen so richtig gut vorstellen konnten.
Nur die dritte Variante entsprach dem, was ich wirklich getan hatte.
Die quantitative Erfassung in Zeitwerten aber ließ völlig offen, wie hier gearbeitet wurde.
Ich hoffte nun, dass mein Träger auf diese Weise erkennen würde, dass diese Art der Kontrolle völlig unsinnig ist, da sie ihr Ziel verfehlt. Außerdem forciert sie meiner Meinung nach bei uns MitarbeiterInnen ein nicht-fachliches, quantifizierendes Verständnis von Sozialer Arbeit und deprofessionalisiert.
Mein Träger hat geschmunzelt, mit den Schultern gezuckt und nur gesagt: Der Kontroll-Bogen sei in Absprache mit dem Jugendamt entstanden und es läge nicht in seiner Macht ….“
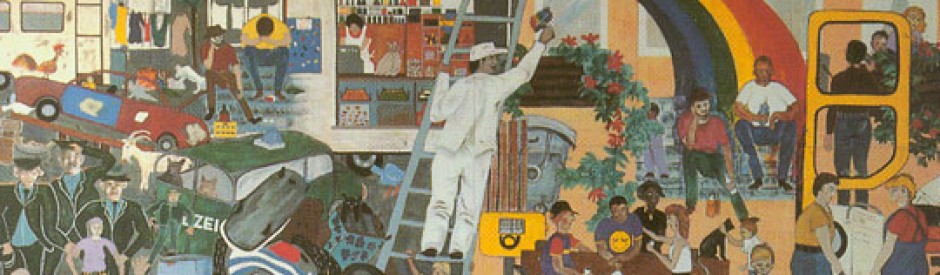
Bravo!