Frage eines Zuhörers bei der Vorstellung meines Buches in Berlin am 4.12.25 (verdi-Veranstaltung):
„In meiner persönlichen Praxis ist mir bei der verzweifelten Suche nach passenden Hilfsangeboten immer wieder begegnet, dass sich Sozialarbeitende als nicht zuständig erklären. Die Drogenberatung will keine Anträge auf Sozialhilfe ausfüllen. Der Straßensozialarbeiter darf die Grenzen des Bezirks nicht verlassen. Es ist ein bisschen wie am Fließband: Jeder ist nur für einen Teilschritt verantwortlich. In deinem Buch greifst du das auf und schreibst, dass die Soziale Arbeit eine Spezifizierung und Zuständigkeitsbegrenzung verweigern sollte. Kannst du das erklären?„
Eine Geschichte aus den ersten Tagen der lebensweltorientierten Schulsozialarbeit…
Da fällt mir eine Geschichte aus der Pionierzeit der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit ein. Anne Frommann war eine der ersten professionellen SozialarbeiterInnen, die in den 70ger Jahren eine Anstellung als Schulsozialarbeiterin in einer Schule bekam. Und als sie am ersten Morgen im Lehrerkollegium auftauchte, wurde sie freundlich und neugierig von den KollegInnen begrüßt. „Und was ist Ihr Fach?“ wurde sie sofort gefragt – denn darüber hatte sich die Schulleitung ausgeschwiegen.
„Lebenswelt“, antwortete Anne Fromann und sah lächelnd in die verblüfften und irritierten Gesichter der neuen KollgegInnen.
Unser Fach ist die Lebenswelt, nicht ein Teil von ihr
Unser Fach ist die Lebenswelt, nicht ein Teil von ihr, keine Spezialisierung auf irgendeinen Bereich oder ein bestimmtes Thema. Es gibt nichts, was zur Lebenswelt eines Menschen gehören kann, das die Soziale Arbeit nicht prinzipiell etwas angehen könnte.
Das bedeutet, dass sie zunächst als AnsprechpartnerIn für alle Themen offen sein sollte, diese ernst nehmen und sich nicht hinter angeblicher Nichtzuständigkeit zurückziehen kann.
Man nennt das in der Profession „Allzuständigkeit“.
Dieser Begriff ist heute in neoliberalen Zeiten allerdings fast getilgt, zumindest sehr unbeliebt und gilt vielen sogar als Hinweis darauf, dass SozialarbeiterInnen „von vielem ein bisschen aber von nichts wirklich genug wissen“… wird also als ein Merkmal der angeblichen Unprofessionalität gegeißelt. Stattdessen steigt derzeit das Ansehen einer Einrichtung, je mehr sie sich als spezialisiert darstellt und verhält.
Allzuständigkeit als Alleinstellungsmerkmal der Profession
Allzuständigkeit ist keineswegs ein Makel oder Mangel, sondern das Alleinstellungsmerkmal unserer Profession. Dem Aspekt Allzuständigkeit sollte die professionelle Konzeption eine große Beachtung schenken, weil gerade in ihr die besondere Rolle und Funktion Sozialer Arbeit im Vergleich zu anderen Hilfesystemen und Hilfeberufen deutlich wird. Sie ist die einzige Profession, die auf die Ganzheitlichkeit der menschlichen Lebenswelt ausgerichtet ist und sich einer Spezialisierung und Zuständigkeitsbegrenzung verweigern sollte, um für die Klientel einen offenen und unmittelbaren Zugang zu ermöglichen. Das Prinzip der Allzuständigkeit berücksichtigt vor allem auch die Ganzheitlichkeit der Problemlagen.
Da dieses Alleinstellungsmerkmal inzwischen kaum noch bekannt ist und vor allem völlig falsch interpretiert wird, sollte es deutlich von dem abgegrenzt werden, was entsprechend landläufigen Vorurteilen darin gesehen wird. Es geht weder um Allmachtgefühle noch um die Meinung, alles zu können.
Das Merkmal der „Allzuständigkeit“ der Profession Soziale Arbeit bedeutet nicht, dass diese sich anmaßt, alle Probleme abschließend lösen zu können. Es geht vielmehr darum, dass sie – als zuständig für die komplexe Lebenswelt von Menschen – keine Themen von vorneherein für sich ausschließt.
Das professionelle Konzept fokussiert nicht von vorneherein einen bestimmten Aspekt oder Teil der Lebenswelt, vielmehr sind alle Aspekte für die aktuelle Problematik von möglicher Bedeutung und müssen im Blick behalten werden. Galuske (2007, S. 42) spricht in diesem Zusammenhang von „Themenoffenheit“ bzw. einer „Allzuständigkeit „der Sozialen Arbeit. „Man könnte die These formulieren, dass all die Alltags- und Lebensprobleme zum Gegenstand sozialpädagogischer Interventionen werden können, die die eigenen Hilfepotentiale übersteigen und für deren Bearbeitung sich im Prozess der Modernisierung keine speziellen Professionen herausgebildet haben (etwa der Psychotherapeut für neurotische und psychotische Störungen, der Jurist für Rechtsprobleme usw.“.
Unzutreffende Vorstellungen von Allzuständigkeit
Selbstverständlich kann eine einzelne SozialarbeiterIn niemals Fachmensch für alles sein. Es geht auch nicht darum, dass Soziale Arbeit quasi alles zu einem sozialpädagogischen Problem erklären will. Der Begriff Allzuständigkeit impliziert vor allem, „dass es eine enorme und diffuse Bandbreite von Problemen gibt, die prinzipiell zum Gegenstand Sozialer Arbeit werden können“ (Galuske 2007, S. 37).
Thiersch betont, dass diese schwierige Struktur Sozialer Arbeit – „das Grundmuster von Ganzheitlichkeit, Offenheit und Allzuständigkeit“ (Thiersch 1993, S. 11) – nicht ein beklagenswerter oder dringend zu überwindender Zustand der Sozialpädagogischen Profession sei, sondern vielmehr für Soziale Arbeit konstitutiv. Man könnte sagen, alles, was das alltägliche Leben von Menschen hergibt, kann zum Gegenstand sozialpädagogischer Intervention werden. (vgl. auch Galuske 2007; Seithe 2012).
Ähnlich wie ein Allgemeinmediziner muss Soziale Arbeit über eine breite Qualifikation verfügen, die es ihr erlaubt mit sehr verschiedenen Fragestellungen und Problemen etwas anfangen zu können. Darüber hinaus sollte sie allerdings ihre Grenzen kennen und wissen, an welchem Punkt sie KollegInnen aus anderen Berufsgruppen hinzuziehen muss. Und sie muss informiert sein über das, was andere Professionen oder Einrichtungen leisten können (vgl. B. Müller 2017, „Fall für“). Denn es geht ganz sicher nicht darum, andere Hilfeansätze auszuschließen, die im konkreten Fall weitergehender und tiefgreifender helfen können.
Allzuständigkeit ist wichtig für unsere spezielle Klientel
Eine sehr oft nicht bedachte Bedeutung dieses Handlungsmerkmals für die Klientel der Sozialen Arbeit muss besonders hervorgehoben werden und stellt letztlich die ausschlaggebende Begründung dafür dar, warum gerade dieses Merkmal für die professionelle Soziale Arbeit von so großer Bedeutung ist:
Das ganzheitliche Herangehen an die Problemlagen der Klientel und die professionelle Allzuständigkeit der Hilfe kommen denjenigen KlientInnen entgegen und zugute, die ihren Hilfebedarf nicht als die Summe einzelner Probleme, sondern als komplexe, ganzheitliche Problemlage erleben und auch artikulieren. Sie können sich von dieser Komplexität nicht lösen und erleben Hilfe auch nur dann als wirklich hilfreich, wenn sie nicht (wegen Nichtzuständigkeit) „von Pontius zu Pilatus“ geschickt werden. Für sie ist die Bereitschaft der Sozialen Arbeit, sich genau auf diese komplexe Problemstruktur einzulassen, wichtig und die Voraussetzung dafür, dass sie die Hilfe in ihr Leben integrieren können.
Wenn die Soziale Arbeit sich gegenüber den sozialbenachteiligten Menschen unserer Gesellschaft verantwortlich fühlt, so muss sie diesen Menschen angemessen begegnen und sie nicht mit Logiken und Denkgewohnheiten verunsichern und überfordern, die vielleicht für ein Mittelschichtklientel und für gebildete Menschen kein Problem darstellen.

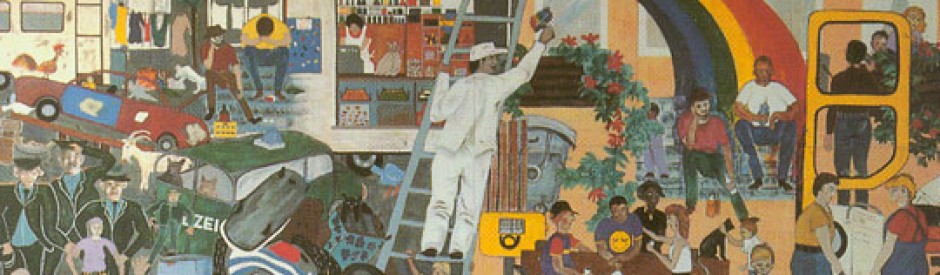



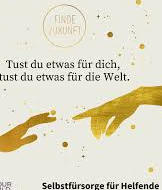
Bravo!