Anmerkungen zu einem interessanten Buch:
Maja Heiner: Professionalität in der Sozialen Arbeit, Stuttgart 2004
Für ein Seminar im kommenden Semester habe ich mir heute Maja Heiners: Professionalität in der Sozialen Arbeit (von 2004) genauer angesehen.
Das Buch ist erst einmal deshalb erfreulich,
- weil es lesbar ist und z.B. einen guten Überblick über die Geschichte der Professionalitäts-diskussion innerhalb der Sozialen Arbeit gibt.
- Es ist ferner sehr hilfreich, weil es die Kritierien für professionelles Verhalten versucht zu operationalisieren und am konkretem Handeln festzumachen.
- Die Analyse konkreter Praxisbeispiele ist sehr aufschlussreich und bildet die Vielfalt von Praxis hinsichtlich ihrer mehr oder weniger gelungenen Umsetzung von Professionalität anschaulich ab.
Die Kriterien von Professionalität, die Maja Heiner entwickelt und begründet sind nachvollziehbar und entsprechen auch meinen Vorstellungen einer professionellen Sozialen Arbeit. Also sehr wohl lesenswert…
Dennoch möchte ich zu einigen Aussagen von Maja Heiner hier kritische Anmerkungen machen.
Bei der Geschichte der Professionsdiskussion und auch bei ihren Aussagen zur Wirklichkeit der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen heutiger Sozialer Arbeit bin ich über einige Merkwürdigkeiten gestolpert, über die es m. E. lohnt, zu diskutieren:
Maja Heiner nimmt die Position ein, dass – ganz im Unterschied zu den marxistisch beeinflussten Ansätzen der 70er und noch der 80er Jahre – heute endlich eingesehen würde, dass es in der Sozialen Arbeit nicht um einen unauflösbaren Widerspruch zwischen gesellschaftlichen Interessen und den Interessen der Menschen gehe, dass es also keine echte Paradoxie im Verhältnis zwischen Hilfe und Kontrolle, zwischen den Mandaten der Klientel und des Systems gäbe, und dass sich heute die Einschätzung der Natur der polaren Beziehugnen geändert habe. Der Sozialen Arbeit sei damit eine intermediäre Funktion zuzuordnen, „die der Vermittlung zwischen den Ansprüchen der Gesellschaft und den Bedürfnissen der Individuen dient“ (Heiner, 2004, S. 30). Ein politisches Mandat der Sozialen Arbeit im Sinne einer Positionierung gegen den Staat, das System etc. hält sie für illusionär (S. 36) und für die Profession unangemessen.
Was ist davon zu halten?
Natürlich gibt es nicht nur grundlegende Widersprüche zwischen den Interessen des Systems und denen der Menschen. Es besteht nicht in jedem Fall und in jeder Situation notwendig ein unauflösbarer Widerspruch zwischen den beiden Polen. So ist z.B. das Kindeswohl gleichermaßen für das System wie für die Betroffenen elementar wichtig, ebenfalls der Schutz vor Selbstgefährdung. Andere gesellschaftliche Erwartungen und Normen sind aus professioneller Sicht zu akzeptieren, weil sie das zwischenmenschliche Zusammenleben und die Intergration Einzelner in die Gesellschaft sichern können, z.B. der Schutz vor Fremdgefährdung, usf. All diese Anforderungen gesellschaftlicher Art beschreiben aber Widersprüche, die sich vielleicht für die Klienten subjektiv so anfühlen mögen, die aber nicht tatsächlich gegen sie gerichtet sind bzw. die für sie und ihr Verhalten Grenzen makieren, die das Zusammenleben der Menschen sichern.
Maja Heiner leitet aus der erforderlichen Aufgabe und Kompetenz zur Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft bzw. Sozialität ein wesentliches Professionsmerkmal Sozialer Arbeit ab. Sie stellt fest, dass Soziale Arbeit die „Widersprüche, die aus den Konflikten zwischen Individuum und Gesellschaft resultieren, ausbalancieren muss, um mehr soziale Gerechtigkeit zu erreichen“ (S. 32). Sie sieht hier die Chance einer „Versöhnung von Individuum und Gesellschaft“. Als Beleg dafür, dass der angeblich unversöhnliche Widerspruch zwischen den Erwartungen des Systems und der Menschen aufgelöst wurde oder werden kann, führt Heiner die in der heutigen Sozialen Arbeit vorherrschende Vorstellung der Koproduktion an, bei der die Klientel aktiver Partner im Hilfeprozess ist und sie bemüht die Erkenntis der Systemtheorie, nach der Systeme nur selber, und nicht von außen induziert, in der Lage sind zu lernen. Tatsächlich ist die Soziale Arbeit in den letzten 30 Jahren einem handlungsorientierten Professionsverständnis näher gekommen, das ihr ermöglicht, sowohl etwas für die Klientel zu tun, als auch ihre Lebensbedingungen zu verbessern, indem sie die Klientel zur Koproduktion bewegt und sie als Akteurin und Expertin ihres eigenen Lebens respektiert und stärkt.
Zu Heiner’s Professionalitätsverständnis gehören folglich unabdingbar eine Haltung zum Klienten, die ihn respektiert, die von seiner Entwicklungsfähigkeit überzeugt ist, die seine Partizipation und Koproduktion am Hilfeprozess als notwenig erachtet und die deshalb seine Motivierung nicht nur für nötig hält, sondern diese als eine zentrale Aufgabe der Sozialen Arbeit erkennt. Dies ist der Professionalitätstyp der „Passung“, den sie den unprofessionellen bzw. semiprofessionellen Typen insbesondere des „Dominanz“- und des „Service-Modells“ gegenüberstellt. Damit distanziert sie sich z.B. von einer autoritären, patriarchialischen Sozialen Arbeit ebenso wie von einem reinen Managementmodell, das den Beziehungsaspekt und damit jene Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft nicht leistet oder zu leisten bereit ist.
So weit kann ich Maja Heiner problemlos folgen und denke, dass ihre Argumentation geradezu hervorragend geeignet ist, gegen neuere Sozialarbeiterische Konzepte Front zu machen, die mit dem aktivierenden Staat und der Ökonomisierung ins Haus stehen.
Dennoch scheint Maja Heiner von den Bedrohungen und Beinträchtigungen der Professionalität Sozialer Arbeit, die durch die Ökonomisierung und den aktivierenden Staat ins Haus stehen, (noch?) scheinbar völlig unberührt. Die Frage der Professionalität ist für sie zunächst und zu allererst eine Frage der Haltung der Sozial Arbeitenden. Sie sind in erster Linie aufgerufen, an ihrer Professionalität zu arbeiten.
Und hier fangen meine Probleme mit ihrem Standpunkt an:
Es gibt gerade in der heutigen Zeit Erwartungen des Systems, die den Interessen der Menschen subjektiv und objektiv widersprechen, z.B. die schnelle Widereingliederung in den Arbeitsprozess, koste es was es wolle. Die Vermittlung des flexiblen und unternehmerischen Habitus ist z.B. zumindest dort, wo die Ressourcen für eine solche Lebensweise nicht reichen, gegen die Lebens- und Überlebensinteressen der Betroffenen gerichtet. Es gibt systemische Erwartungen und Interpretationen gesellschaftlicher Normen, die politisch vorgegeben werden und keineswegs akzeptabel sind, wenn es der Sozialen Arbeit z.B. um die Selbstbestimmung und die Menschenwürde ihrer Klientel, um deren Selbstverantwortung und Eigenveränderung und die Ganzheitlichkeit ihrer Lebenswelt geht.
Maja Heiner geht auf solche Aspekte in ihren Überlegungen aber gar nicht ein. Sie betont immer wieder und belegt es mit den Aussagen der von ihr interviewten SozialpädagogInnen, dass nicht die Gesellschaft oder das System den Sozialarbeitenden Beschränkungen hinsichtlich Methodenwahl, Zielstellung und Prozess ihrer Arbeit vorgeben. Das mag der Tatsache geschuldet sein, dass Maja Heiner dieses Buch 2004 geschrieben hat, in einer Zeit, wo die Wirklichkeit der Ökonomisierung noch nicht überall in der Praxis und schon gar nicht in den Köpfen angekommen war. Solche Widersprüche waren in den 80er und 90er Jahren tatsächlich nicht so deutlich erfahrbar. Für diese Zeit kann ich bestätigen, was Heiner 2004 noch behauptet: dass man als SozialarbeiterIn im Wesentlichen frei und unbehelligt das tun konnte, was man fachlich für notwendig erachtete.
Die heutigen, sehr deutlichen Widersprüche zwischen System und Lebenswelt aber werden von Heiner offenbar ausgeblendet. Für sie bedeutet die Erkenntis der Notwendigkeit einer „freiwilligen Selbstveränderung“ der Klientel gleichzeitig die Infragestellung des doppelten Mandates und der angeblichen Paradoxie von Hilfe und Kontrolle. Heute, so Heiner, verfolge die Soziale Arbeit einen dritten Weg „zwischen vollständiger Selbstaufgabe und Anpassung einerseits und der Durchsetzung eigener Interessen in frontaler Konfrontation zur Gesellschaft andererseits“ (s. 31). Aus meiner Sicht verwechselt Heiner hier die Begriffe Gesellschaft und System. Und sie unterstellt, dass Widersprüche dann keine mehr sind, wenn sie angenähert und aufgeweicht und in ihren direkten Auswirkungen abgeschwächt werden können, wenn man sich sozusagen entgegenkommen kann. Es ist schon richtig: Soziale Arbeit kann und will die grundlegenden gesellschaftlichen Strukturen nicht verändern, insofern ist sie ein Kind und ein „Agent“ der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie trägt durch ihre „Versöhnungsarbeit“ tatsächlich auch zur Befriedung bei. Die angestrebte „Versöhnung“ von sozial benachteiligten der Menschen mit den sie benachteiligenden Folgen der gesellschaftlicher Verhältnisse, so wie sie die Soziale Arbeit durch Beratung, Hilfe zur Selbsthilfe, durch „Sekundäre Integration“usw. mit dem Betroffenen zusammen vollbringen kann, bedeutet keine wirkliche Aufhebung dieser Widersprüche. Es handelt sich hier nur um Abmilderungen, Annäherungen, um die Suche nach Verträglichkeiten, um Kompromisse, um Konzepte des Arrangierens – im besten Fall ohne gebrochenes Rückgrad. Die konkreten behindernden oder benachteiligenden gesellschaftlichen Probleme und ihre Folgen aber bleiben bestehen, daran kann Soziale Arbeit bekanntlich nichts ändern.
Das aber bedeutet durchaus nicht, dass Soziale Arbeit nur Anpassung vermitteln kann. Sie ist gleichzeitig eine gesellschaftliche Kraft, die zur „Emanzipation“, zum Empowerment ihrer Klientel beitragen kann und will. Indem sie nämlich versucht, die Folgen der gesellschaftlichen Strukturen für ihre Klientel abzumildern, ihrer Klientel ein Überleben und Leben in Würde und Teilhabe in der kapitalistischen Gesellschaft zu ermöglichen, stellt sie ein Überlebenskonzept dar, ohne das diese scheitern würden. Und sie leistet damit für und mit diesen Menschen gleichzeitig Widerstand, indem sie die Menschen befähigt, sich zu den sie beeinträchtigenden Verhältnissen aktiv zu verhalten.
Aber es hängt dann jeweils von den konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen und Ideologien ab, ob und wieweit diese „Emanzipation“ der gesellschaftlich Benachteiligten gewünscht, zugelassen und akzeptiert wird.
Die Position von Maja Heiner zur Frage der Professionalität ist durchweg optimistisch. Eine Bedrohung der Professionalität aus der Ecke Politk, Ökonomie und Staat scheint sie nicht wirklich erst zu nehmen. Für sie ist die Professionalität zunehmend gesichert in dem Maße, wie die alten dichotomen Vorstellungen zwischen den Interessen der Menschen und denen des kapitalistischen Systems aufgegeben wurden und einer pragmnatischen, komplexen und fallspezifisch angemessenen Handhabung gewichen sind. Sie beschreibt eine Art Triumpfzug der Profession für die letzten 20, 30 Jahre. Maja Heiner hebt zum Beispiel hervor, dass die Leitungspositionen in der Sozialen Arbeit zunehmend nicht mehr berufsfremd von Juristen, Verwaltungsfachleuten oder Theologen besetzt werden. Stimmt, ich weiß noch genau, wie stolz auch wir 1980, 1990 darauf waren, dass unser Jugendamtsleiter ein echter Sozialarbeiter war!
Aber schon wenige Jahre danach drangen mit noch viel größerer Selbstverständlichkeit und Anmassung die Betriebswirte und Sozialmanager in die Leistungspositionen der Sozialen Arbeit ein. Hat Maja Heiner davon nichts gewußt, als sie das Buch schrieb? Im Jahre 2004 sollte man doch vielleicht schon mitbekommen haben, dass sich für die Soziale Arbeit ganz neue, tiefgreifende Interessengegensätze aufgetan hatten im Zusammenhang mit der Ökonomisierung und den ideologischen Formen, die die Sozialpolitik inzwischen prägen!
Doch, Maja Heiner geht in ihren Ausführungen schließlich auch auf die Verharmlosung und unangemessene Harmonsierung der bestehenden – aber für sie nicht unversöhnlichen – Widersprüche zwischen System und Lebenswelt ein. Der heute zunehmend verwendete Begriff der Dienstleistung z.B. scheint ihr zurecht ungeeignet, weil er einen Kunden voraussetzt, der so in der Sozialen Arbeit nicht gegeben ist. Soziale Arbeit verliere auf diesem Weg ihre Aufgabe, für all die Menschen tätig zu sein, die nicht in der Lage sind, eine Dienstleistung bewußt und freiwillig für sich in Anspruch zu nehmen. Und die Zumutungen der Ökonomisierung erklärt sie sogar zu den aktuellen zentralen Herausforderungen an die Profession. Heiner beschreibt die großen Gefahren der Ökonomisierung für die Soziale Arbeit und ihre professionelle Ausübung, die heute längst Realität geworden sind.
Aber trotz dieser Erkenntnisse bleibt Maja Heiner ihren vorigen optimistischen Thesen und ihrem schon dargelegtes Verständnis auch im weiteren Verlauf des Textes treu. Sie glaubt an die positiven Versöhnungs- und Verständigungsmöglichkeiten Sozialer Arbeit und sie glaubt, dass damit alle Widersprüche aufzulösen und zumindest zu händeln sind.
Tatsächlich aber bewirken die Erfahrungen mit Ökonomisierung und aktivierendem Staat nahe, dass uns heute die von Maja Heiner als überholt und gestrig abgetane These von der Sozialen Arbeit als Agentin des Kapitalismus mehr als deutlich einholt: Der Staat diktiert der Sozialen Arbeit neue Rahmenbedingungen, neue Ziele, er greift in die Methodenwahl ein, setzt die bisherigen ethischen Grundhaltungen frei und zwingt durch seine ökonomische Steuerung zur Selektion der Klientel. Land auf Land ab haben wir eine Soziale Arbeit, die sich im Rahmen von Unternehmen vollzieht, deren Ziel vorrangig Effizienz und Wirtschaftlichkeit sind, die möglichst preisgünstig, möglichst rationell und möglichst schnell Waren produzieren wollen und müssen.
Es stellt sich zunehmend die Frage, ob die herrschende (Sozial)Politik eine Soziale Arbeit überhaupt brauchen kann, die sich sozialer Gerechtigkeit und der Integration aller Menschen verpflichtet fühlt. Wenn dem aber nicht so ist – und vieles spricht dafür -, hat die professionelle Soziale Arbeit zu ihrer Rettung nichts zu erwarten von der Seite des Systems.
Für Maja Heiner haben im Jahr 2004 Begriffe wie Parteilichkeit oder Politisierung weiterhin und offenbar trotz der Erfahrungen mit der Ökonomisierung keine Bedeutung. Sie geiselt den Begriff der Parteilichkeit, weil sie ihn mit einem kritiklosen Sich-von-Klienten-in-den-Dienst-Nehmen-Lassen und einer naiven Idealisierung von Klienten gleichsetzt. Sie distanziert sich vom politischen Mandat der Sozialen Arbeit, weil sie meint, dass Soziale Arbeit nicht Politik, sondern eben Soziale Arbeit zu leisten habe.
Die Tatsache aber, dass für die Soziale Arbeit die konkrete Bestimmung der Inhalte, Ziele, Formen und Grundhaltungen durch die aktuelle Politik von elemantarer und existentieller Bedeutung ist, da sie ja, wie Maja Heiner selber bestätigt, von der Politik direkt abhängig ist, wird von ihr nicht weiter verfolgt. Doch genau hier stellt sich die Frage des poltischen Mandates unserer Profession:
Die Geister scheiden sich an der Frage, ob die Soziale Arbeit – als Erfüllungssgehilfin des Systems – alles schlucken muss, was ihr auf der politischen Bühne vorgegeben wird oder aber, ob es die Soziale Arbeit – trotz ihrer Abhängigkeit und Eingebundenheit – etwas angeht und etwas angehen darf, wie die Politik, wie das Menschenbild dieser Politik, wie ihre politische Praxis im Umgang mit Menschen aussehen.
Ich bin nicht der Meinung, dass unserer Profession nur Resignation und Anpassung bleiben, weil sie ja in finanziellen, rechtlichen und institutionellen Abhängigkeiten gebunden ist. Ich gehe davon aus, dass sie sich gegen solche Erwartungen und Vorgaben wehren muss und zwar deutlich und ohne Konfliktscheu.
Mit ihrer Berufung auf (sozial)wissenschaftliche Wissensbestände, auf die sozialpädagogische Ethik, ihre Kompetenz, bei den Klienten durch Ressourcenorientierung, Ganzheitlichkeit und der respektvollen Beachtung ihres „Eigensinns“ (wirkliche) „freiwillige Selbstveränderung“ zu ermöglichen, durch die Autonomie ihrer fachlichen Entscheidungen im Umgang mit dem konkreten Fall in der konkreten, je einmaligen Situation, stellt sie eine Profession dar, die mit ihren fachlichen Mitteln sehr wohl autonom und verantwortlich gesellschaftliche Aufgaben zu lösen im Stande ist. Ihre faktische gesellschaftliche Abhängigkeit sollte sie nicht daran hindern, die Bedingungen für die Ausübung ihrer Profession von der Gesellschaft zu fordern und einzuklagen.
Das aber wird sich nicht allein mit dem umsetzen lassen, was die Fachliteratur als „störrisches Beharren auf fachlichen Positionen“ bezeichnet. Die Möglichkeiten, auf die Herausforderungen des neoliberalen, aktivierenden Staates mit bewußter Professionshaltung zu reagieren, sind begrenzt. Sicher kann durch fachliche Klarheit und fachliche Selbstsicherheit so einiges abgefedert und auch gemildert werden. Es muss auch darum gehen, die problematischen politischen Vorstellungen und Positionen offenzulegen, ihre Folgen und ihre Absichten zu enttarnen und damit als Soziale Arbeit offen und offensiv in eine politische Auseinandersetzung einzutreten.
Als von der Gesellschaft abhängige Profession ist sie zwar sehr wohl als Anpassungsinstrument zu missbrauchen. Als „geborene Kritikerin des Kapitatlismus“ aber hat sie auch das Zeug zu einem politschen Mandat: Sie hat die Informationen über gesellschaftlich induzierte Notlagen und Einblicke in die Lebenslagen der Menschen, und sie kennt die Visionen und Hoffnungen der Klienten auf ein menschenwürdiges Leben. Darüber hinaus verfügt sie über die Fähikgeit, komplexe Zusammenhänge konkret und nachvollziehbar zu verdeutlichen.
Das doppelte Mandat, das Maja Heiner 2004 als überholte Vorstellung abtut, ist heute sehr wohl mit vielen auch unversöhnlichen Widersprüche belastet. Die jüngste Zeit bringt dafür täglich neue Beispiele hervor. Es ist aus meiner Sicht die Aufgabe der professionellen Sozialen Arbeit, sich in diesen Konflikten mit ihren Mitteln und im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die Seite derer zu stellen, die tatsächlich die Schwächeren in diesem asymetrischen Verhältnis sind. Auch darin vollzieht sich Professionalität. Und in diesem Sinn verstanden gehört Parteilichkeit zu ihren Grundmerkmalen.

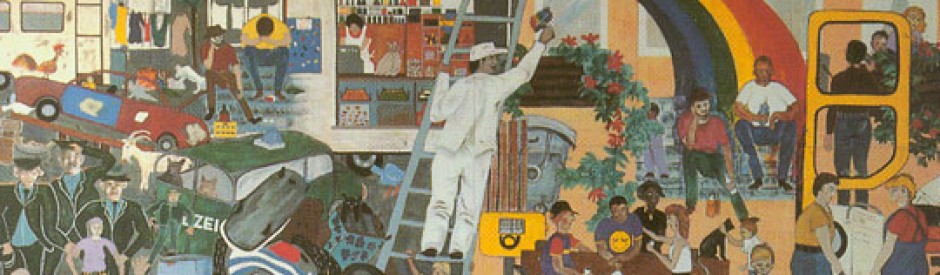









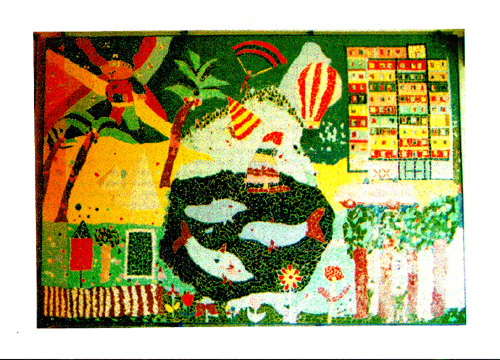


Bravo!