SYMPOSIUM I am 1. Abend (24.9.09)
Es ging um das Thema: Politik der Profession als Stärkung des Sozialen – Herausforderung und Verantwortung der Sozialen Arbeit als gesellschaftliche Aufgabe.
Hans Uwe Otto hatte auf dem Plenum Vertreter der gewerkschaftlichen und berufsständigen Organisationen versammelt, die eine für ihn erkennbare Vertretungsposition der Profession Soziale Arbeit einnehmen: die beiden Gewerkschaften ver.di und GEW sowie den Berufsverband DBSH. Michael Leinenbach vertrat den DBSH, Norbert Hocke die GEW und Harald Giesecke die Gewerkschaft ver.di.
Hans Uwe Otto formulierte seine Erwartungen: Es ginge darum, dass hier echte Vertretungspositionen eingenommen würden und der Sozialen Arbeit als Sprachrohr dienten. Ziel sei es, dass Soziale Arbeit selber mitdefiniere und nicht weiter von außen definiert würde. Ferner sei es notwendig, dass sich Soziale Arbeit und ihre Vertreter in die aktuellen Debatten um sozialpolitische Fragen aus professionspolitischen Gründen einmische und am besten dabei die Führungsrolle übernähme. Die Wohlfahrtsverbände könnten dies nicht leisten, sind sie doch in diesem Prozess auf der Arbeitgeberseite und vertreten ihre eigenen Interessen.
Der derzeitige Zustand der Sozialen Arbeit wurde einvernehmlich kritisch gesehen. ZB. stellte man fest, dass aus einem Vollzeitberuf zunehmend ein Teilzeitberuf gemacht wird. Die derzeitige Zunahme von Stellen in der Sozialen Arbeit kommen zudem fast ausschließlich dem Kindertagesstättenbereich zugute (+3%). In der Jugendhilfe insgesamt gibt es ein „Wachstum“ von -2,1%, davon in der Jugendarbeit -28% und in der ambulanten Erziehungshilfe -12,5%. Kritisiert wurde, dass sich die Finanzierung z.B. auch in den Kindertagesstätten heute nicht mehr an den pädagogischen Notwendigkeiten, sondern bloß an der reinen Anwesenheit der Kinder aus. Das bedeutet, dass die Professionspolitik gegenwärtig unter einem reinen Finanzdiktat steht und nicht den Lebenslagen und Lebensbedürfnissen der Betroffenen entspricht. Es geht auch nach Meinung der gewerkschaftlichen und berufständigen Vertreter darum, dass die Soziale Arbeit die Definitionsmacht über ihre eigene Arbeit zurückgewinnt.
Die von allen geforderte politische Einmischung der Sozialen Arbeit und ihrer Vertreter bezog sich vor allem auf die Schaffung von Arbeitsbedingungen, die „eine gehaltvolle Arbeit möglich machen“. Der vielleicht von Hans-Uwe Otto oder auch von TeilnehmerInenn des Symposiums erhoffte politische Aufschrei erklang moderat.
Der geringe Organisiertheitsgrad im Bereich der Sozialen Arbeit wurde allgemein bedauert. Der Vertreter der GEW stellte fest, dass es bisher nicht gelungen sei, für diese und mit dieser Gruppe ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln . Die Existenz unterschiedlicher Träger (freier und öffentlicher) und Arbeitsfelder führe zu einem zunehmenden Splitting in der Branche. Hinzu komme, dass der kirchliche Bereich z.B. bei Tarifabschlüssen immer eigene Wege geht. Zudem gibt es eine Fülle verschiedener Verbände, Gruppierungen und Arbeitsgemeinschaften, die jeder für sich Aussagen zur Profession treffen (z.B. dv, AGJ).
Ideen, wie der Grad der Organisiertheit der Sozial Arbeitenden erhöht werden könnte, gab es kaum. Es entstand der Eindruck, dass in den Verbänden die Vorstellung vorherrscht, die interessierten Sozial Arbeitenden könnten und müssten von selber an ihre möglichen Vertretungsorganisationen herantreten. Man verwies auf Broschüren, Plattformen, Satzungen und Informationsmaterial. Der Vorschlag, sich in den Hochschulen vorzustellen, wurde wenig begrüßt, da man ja mit der Ausbildung selber nichts zu tun hätte.
mein Kommentar:
Was die professionellen Sozial Arbeitenden heute brauchen würden, wäre ein gesellschaftlicher Ort und eine konkrete Gemeinschaft, in der sie ihre berufspolitischen und sozialpolitischen Themen und Anliegen – unabhängig von Trägern, Arbeitgeber, Arbeitsfeldern und Zielgruppen – besprechen, diskutieren, hinterfragen dürfen, wo sie die Gemeinsamkeiten ihrer Lage erkennen und Solidarität entwickeln können, wo politische Strategien erarbeitet werden und Ideen für Aktionen entstehen und wo sowohl politisches Bewusstsein als auch berufspolitisches Selbstbewusstsein wachsen kann.
Dieser gesellschaftliche Ort könnte jede der drei auf diesem Symposium vertretenen Organisationen sein. Es geht aber nicht darum, dass Funktionäre sich für die da unten ihre Köpfe zerbrechen und die sich dann irgendwelche Dienstleistungen abholen. Eine neue Bewegung kann nur von unten, von der Basis ausgehen. In jeder Stadt könnte es solche Gruppen (von GEW, ver.di oder DBSH) geben, wo sich engagierte, kritische Sozial Arbeitende regelmäßig treffen und austauschen und wohin sich auch jeder wenden kann, wenn er mit Problemen im Zusammenhang seiner Arbeit konfrontiert ist, gegen die er oder sie als Einzelne nichts ausrichten können.
Und genau solche Gruppen könnten sehr wohl auch schon StudentInnen der älteren Semester aufnehmen. Denn die suchen ganz dringend einen Identitätsort für ihre Professionalität , der sie beim Übergang in die Berufspraxis vor dem Schicksal bewahren kann, alleine da zu stehen, sich zwangsläufig anpassen zu müssen und alles zu vergessen, was sie über die gegenwärtige Lage der Sozialen Arbeit begriffen haben.
Was von den VertreterInnen der Gewerkschaften und des Berufsverbandes dann aber erwartet würde, ist: Unterstützung dieser Gruppen in räumlicher, materieller Hinsicht, Einbindung in die Beziehungen und Weiterbildungsmöglichkeiten der Organisation, Unterstützung der Aktionen und der entwickelten Forderungen und politische und rechtliche Rückendeckung!
.
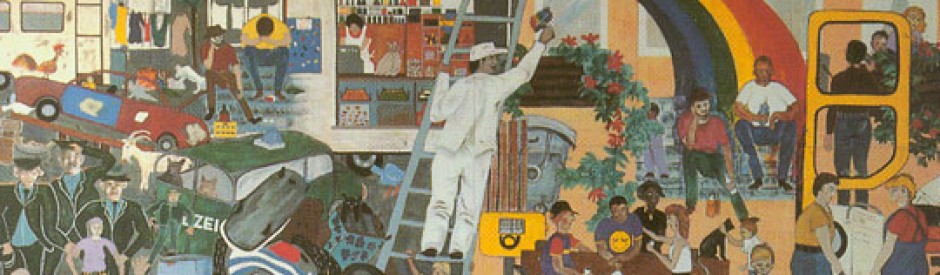





Bravo!