Jeder kämpft für sich allein?
Gedanken zur Notwendigkeit der (Wieder)Entdeckung der Solidarität in der Sozialen Arbeit
veröffentlicht im Forum Sozial 3/2010 des DBSH.
Soziale Arbeit ist bekanntlich einerseits eine
Instanz, die das gesellschaftliche System stabilisieren hilft, aber
gleichzeitig auch eine politische Kraft, die mit Blick auf die
gesellschaftlich induzierten Problemlagen von Menschen im
kapitalistischen Gesellschaftssystem eine kritische Sicht auf die
gesellschaftlichen Verhältnisse entwickelt (vgl. z.B. Böhnisch et al.
2005, S. 103), politisch aktiv werden und die Menschen befähigen kann,
sich gegen das System und seine Zumutungen zur Wehr zu setzten.
Das Verständnis der Sozialen Arbeit als politische
Kraft schlägt sich in ihren ethischen Grundhaltungen und ihrem
Aufgabenverständnis nieder: in der Parteilichkeit (mit der Klientel) und
in der Solidarität (mit Gleichgesinnten). Es verknüpft das berufliche
und (sozial-) politische Handeln auf verschiedenen Ebenen miteinander.
Parteilichkeit für die Klientel der Sozialen Arbeit ist
das Bemühen trotz des immer auch bestehenden gesellschaftlichen
Auftrages sich im Sinne des Mandates für die Menschen für deren
Bedürfnisse und Bedarfe einzusetzen und mit ihnen zusammen deren
Interessen zu verteidigen im Zweifel auch gegen die Interessen des
Systems (vgl. z.B. Thiersch 1993, S. 13). In jüngster Zeit gerät die
Parteilichkeit immer mehr in Verruf und wird als unwissenschaftlich und
nicht mehr zeitgemäß kritisiert.
Solidarität bedeutet, sich mit
anderen Menschen zusammen für die gemeinsamen Interessen einzusetzen,
sich dabei gegenseitig zu stützen und gemeinsam gegen die Verhältnisse
zu kämpfen, die diesen Interessen im Wege stehen. Sie kann sich auf
unterschiedlichen Ebenen umgesetzt werden.
- Zum einen bedeutet sie das politische Engagement
für soziale Gerechtigkeit. Hier geht es um die Frage, ob und
wieweit die Profession an der Gestaltung des Sozialen und an der
Schaffung von Solidarität mitwirken kann, will und muss (vgl. z. B.
Lange/Thiersch 2006, S.217).
Dieses Verständnis von Sozialer Arbeit als einer
gesellschaftspolitischen Kraft, war zumindest in den 70er Jahren im
Zuge der Kritik an der damaligen vorherrschenden
sozialarbeiterischen Praxis durchaus verbreitet. Heute ist ein
solches Verständnis von Sozialer Arbeit aber fast vergessen.
- Im engeren Sinne bedeutet Solidarität für Sozialarbeitende den gemeinsamen Einsatz der Berufsgruppe für berufs- und fachpolitische Interessen
der Profession, z.B. für eine angemessene Bezahlung oder z.B. für
die Sicherstellung der für qualifizierte Soziale Arbeit
erforderlichen Arbeitsbedingungen. Dieser wäre gerade angesichts
der zunehmenden Deprofessionalisierung und Prekarisierung der
Sozialen Arbeit bitter notwendig.
Die Solidarität innerhalb der Berufsgruppe war selbst in den 70er Jahren
nicht besonders ausgeprägt. Zwar wurden Kooperation, Teamarbeit
und Vernetzungsarbeit unter sozialen Fachleuten hoch gehalten.
Gemeinsame Aktivitäten, z.B. um eine bessere tarifliche
Eingruppierung durchzusetzen, gehörten aber nie zu den zentralen
Tugenden oder Praktiken der Profession.
Im Folgenden soll zunächst in aller Kürze den
Hintergründen für das zunehmende Verschwinden der ethischen
Grundhaltungen in unserer Profession nachgegangen werden. Im Anschluss
möchte ich die Frage aufwerfen, wie es um die heutigen Sozialarbeitenden
bestellt ist: bestehen überhaupt noch Ansätze und Chancen für ein
Verständnis der Sozialen Arbeit, bei dem Parteilichkeit und Solidarität
unverzichtbare Grundhaltungen darstellen?
Der Aspekt der berufs- und fachpolitischen Solidarität innerhalb der Profession Soziale Arbeit wird in den weiteren Überlegungen dabei im Vordergrund stehen.
Parteilichkeit und Solidarität sind keine Nächstenliebe
Der Berufsgruppe der Sozialarbeitenden wird als
Berufsmotivation immer wieder so etwas wie Nächstenliebe unterstellt.
Die Vorstellung von Sozialer Arbeit als selbstloser Nächstenliebe steckt
tatsächlich auch heute noch in vielen Köpfen, auch in denen der
Sozialarbeitenden selber.
Parteilichkeit ist jedoch etwas ganz anderes als
Nächstenliebe. Sie bedeutet das Partei Ergreifen für Schwächere und zwar
aus der ethischen Überzeugung heraus, dass diesen Schwächeren Unrecht
geschehen ist oder geschieht. Ihr Mangel an Ressourcen ist keine
individuelle Eigenschaft und schon gar kein individuelles Versagen,
sondern stellt eine soziale Benachteiligung dar, die nicht zu
akzeptieren ist.
Die Vorstellung, Soziale Arbeit sei letztlich
professionell ausgeübte Nächstenliebe ist aber vor allem auch dafür
mitverantwortlich, dass sich die Sozialarbeitenden seit jeher scheuen,
sich aktiv für ihre eigenen Rechte und Bedarfe einzusetzen. Wer anderen
selbstlos helfen will, so wird offenbar immer wieder gefolgert, der
sollte dabei keine Absichten für sich selber verfolgen.
Die Befreiung der Sozialen Arbeit von der
hartnäckigen Ideologie der selbstlosen Nächstenliebe, die Herleitung der
ethischen Prinzipien Parteilichkeit und Solidarität aus ihrer
sozialpolitischen Tradition und aus den Werten der Aufklärung würden
eine bessere Basis für die Berufsgruppe darstellen, wenn es darum geht,
ihre ethischen Werte gegen die heutigen neoliberalen Forderungen und
Vorstellungen zu verteidigen und abzugrenzen.
Der Verlust des professionellen Kerns der Sozialen Arbeit
Ein weiterer wichtiger Hintergrund für die
mangelnde Solidarität innerhalb der Berufsgruppe ist die Tatsache, dass
sich die Einheitlichkeit, das Gemeinsame, das Verbindende in der
Sozialen Arbeit immer mehr aufzulösen scheint in der unübersichtlichen
Fülle verschiedenster Arbeitsfelder, Organisationsformen,
Produktionsformen, Anstellungsträger usf. Bestimmte Methoden und
Techniken, vorgegebene konkrete Zielvorgaben oder Wirkungsmodelle,
Programme und Zielgruppenaufträge stehen im Vordergrund und verweisen
die Profession mit ihren fachlichen Kompetenzen und ethischen Werten in
den Hintergrund.
Der fachlich-ethische Kern der Sozialen Arbeit, ihr
Charakter als kommunikativer, interaktiver Prozess, der Menschen bei
der Bewältigung ihres Alltags unterstützen soll, verschwindet so immer
mehr (vgl. z.B. Galuske 2003). Ein gemeinsames Verständnis Sozialer
Arbeit, das als Grundlage für eine mögliche Berufsidentität dienen kann,
ist für viele nicht mehr nachvollziehbar und greifbar. Sozialarbeitende
in der Praxis haben deshalb große Schwierigkeiten, in der KollegIn, die
vielleicht in der gleichen Stadt aber in einem ganz anderen
Arbeitsfeld, bei einem anderen Träger, in einem völlig anderen
Aufgabenfeld und unter anderen Zielvorgaben tätig ist, die
BerufskollegIn zu erkennen und eine Ziel-, Haltung und
Interessengleichheit mit ihr auszumachen.
Es wäre vor allem die Aufgabe der Hochschulen,
diesen allen sozialarbeiterischen Aufgaben und Tätigkeiten innewohnenden
Kern der Profession wieder verstärkt zu vermitteln, die spezifischen
Kompetenzen der Sozialen Arbeit zu vermitteln und bewusst zu machen
sowie deren Verteidigung gegen nichtprofessionelle Absichten und
Vorstellungen konkret und aktiv zu erarbeiten. Wenn die Soziale Arbeit
sich als Ganzes mit gemeinsamen Interessen wahrnehmen könnte, hätte sie
eine wichtige Voraussetzung geschaffen für ein politisches
Selbstverständnis und auch für die Entstehung und Ausübung von
Solidarität untereinander.
Die neoliberale Umkremplung und ihre Folgen für das Verständnis von Parteilichkeit und Solidarität
Inzwischen hat der Neoliberalismus als die derzeit
herrschende und gesellschaftlich verordnete Ideologie die Soziale
Arbeit, wie ja auch die Gesellschaft insgesamt, mehr verändert, als wir
es uns mitunter eingestehen wollen.
Ein Verständnis von Parteilichkeit für Sozial
Benachteiligte und Schwächere liegt dieser Ideologie und diesem Staat
grundsätzlich fern, denn diese setzt die Annahme voraus, dass bestimmte
individuelle Probleme gesellschaftliche Ursachen haben (können) und
somit eine gesellschaftliche Verantwortung für deren Lösung besteht. Die
je individuelle Schuldzuweisung des aktivierende Staates macht
Parteilichkeit nicht nur scheinbar überflüssig, sondern auch
gefährlich, weil sie angeblich die Eigeninitiative der einzelnen
schwächt (vgl. z.B. Nolte 2004).
Der alten Parteilichkeit wird zudem der Geruch
von Irrationalität und Unprofessionalität angehängt. Sie ist angeblich
heute der Dienstleistung gewichen (Lutz 2008). Soziale Arbeit wird zudem
zunehmend zu einem technischen, angeblich personenneutralen Verfahren
der Verhaltensänderung.
Die alte Vorstellung von einer Liebestätigkeit
Sozialer Arbeit aber hat der aktivierende Staat von der professionellen
Sozialen Arbeit abgetrennt und der privaten, persönlich motivierten
Barmherzigkeit anempfohlen und überlassen (vgl. Bütow/Chassé/Hirt 2008, S. 231; Spindler 2007, S. 31; Böhnisch et al. 2005, S. 238).
Mit der Solidarität macht der Neoliberalismus erst recht kurzen Prozess.
Als allgemeine (sozial-) politische Kraft ist
Solidarität ohnehin unerwünscht. Dort, wo jeder für sich alleine zu
sorgen hat, wo jeder für die Risiken seines Lebens alleine einstehen
muss und wo Versagen und Not allein die Schuld des Einzelnen ist und
bleibt, da sind Solidarität und politisches Engagement geradezu kontra
indiziert.
Nur die heimelige und für den Staat kostenfreie
Wärme des sozialen Nahraumes darf das Gesicht der Menschlichkeit und
Solidarität zeigen. Die Nutzung der Bürgerbewegungen und die Aktivierung
der sozialen Nahräume bedeuten ähnlich wie die Barmherzigkeit, die
die Parteilichkeit ersetzen soll das Abschieben der Solidarität ins
Private, Zufällige und vor allem unpolitische (vgl. z.B. Heite 2008, S. 113,114).
Der Solidarität innerhalb der Berufsgruppe
schließlich verabreicht der Neoliberalismus scheinbar den letzten
Dolchstoss: Aus Solidarität wird Konkurrenz und Wettbewerb, aus
Netzwerkarbeit ist längst eine Modernisierungsmethapher für mehr
Effizienz geworden, aus Solidarität unter Gleichen z.B. gegenüber dem
Arbeitgeber wird die Solidarität mit dessen Unternehmen und seinem
wirtschaftlichen Wohlergehen, von dem ja die eigene Existenz abzuhängen
scheint.
Auch unter BerufskollegInnen steht und so soll es
auch sein jeder und jede für sich alleine und damit auch gegen alle
anderen.
Gewerkschaftliche oder berufspolitische Organisation wozu soll das gut sein?
Es ist eine bekannte wenn auch angesichts der
konkreten Berufssituation schwer zu begreifende Tatsache, dass
Sozialarbeitende heute mehr denn je berufspolitische oder
gewerkschaftliche Organisierung für sich nicht in Betracht ziehen. Der
durchschnittliche Organisationsgrad der Sozialarbeitenden in Deutschland
bei Gewerkschaften und Berufsverbänden überschreitet nicht einmal die
10% Marke Warum?
Bei unseren Veranstaltungen im Fachbereich im
vergangenen Sommersemester, bei denen Studierende mit Gewerkschaftlern
und DBSH-VertreterInnen über aktuelle Fragen ins Gespräch kamen, zeigte
sich eine unglaubliche Unwissenschat über zentrale Zusammenhänge
solidarischen Handelns.
Die Studierenden waren nicht nur erstaunt über die
ihnen offensichtlich völlig neuen Informationen im Bezug auf
berufspolitische und gewerkschaftliche Organisationen: Das hatten wir
nicht in der Schule (ja warum eigentlich nicht!!??). Sie hatten vor
allem große Schwierigkeiten, den Sinn einer Organisierung zu verstehen:
Warum sollte ich denn da beitreten? Ich trete doch auch sonst nicht in
jeden Verein ein.
Solidarität wird offenbar von vielen auch als
unnütz angesehen oder der alten Selbstlosigkeitsideologie verdächtigt:
Was nutzt mir das dann? Was gehen mich die andern an. Ich muss mich um
mich und meine Familie kümmern!
Groß aber war immerhin das Staunen darüber, dass
sich z.B. mit dem DBSH jemand wirklich für ihre Interessen einsetzte und
den Wert ihrer Arbeit angemessen einschätzte. Am Abend vorher hatte bei
einer anderen Veranstaltung eine Vertreterin der Arbeitsagentur die im
Osten derzeit üblichen Bruttogehälter von 1500 Euro für
SozialarbeiterInnen verteidigt: Mehr können sie heute eben nicht
erwarten. Und hier, beim DBSH, war nun tatsächlich jemand, der diese
unmöglichen Verhältnisse offen und deutlich anprangerte und als
unerträglich geißelte. Das war eine neue, wichtige Erfahrung für viele
Anwesende.
Aber kurz darauf folgte die reichlich blauäugige
Frage Können Sie denn gesetzt denn Fall ich trete ein dafür sorgen,
dass ich an meiner jetzigen Arbeitstelle mehr Geld bekomme? Und als
das verneint wurde, kam der enttäuschte Kommentar: Aber was bringt es
mir denn dann? Dass es bei der gewerkschaftlichen oder
berufspolitischen Organisierung nicht darum geht, eine Dienstleistung
zur Durchsetzung der eigenen Interessen zu kaufen, dass es vielmehr
darum geht, selber für die eigenen Rechte einzutreten, schien für die
Studierenden keineswegs keines Wegs klar zu sein.
Ein DBSH Mitglied stellte aber schließlich richtig:
Ich weiß, dass die Organisation nicht von heute
auf morgen meine Situation verändern kann. Aber wenn man jetzt nicht
anfängt, was dagegen zu tun, wird es doch immer schlimmer. Und mir
persönlich geht es besser, seit dem ich weiß, ich tue was, ich lasse mir
nicht mehr alles gefallen. Und ich weiß jetzt auch, dass ich dabei
nicht alleine bin. Und wenn wir noch mehr werden, dann werden wir auch
irgendwann Veränderungen erreichen!
Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte den
Eindruck, dass diese Aussagen bei vielen der Anwesenden zwar auf blankes
Staunen, bei einigen aber auf großes Interesse stieß und dort der
Beginn einer neuen Erkenntnis gewesen sein kann.
Wie steht es um das aktuelle politische Selbstverständnis der Sozialarbeitenden?
Als ich 1993 an einer ostdeutschen Hochschule meine
Arbeit aufnahm, sagte ein Student, der im Seminar soeben eine
Kommilitonin hemmungslos vor allen anderen bloßgestellt hatte, zu seiner
Verteidigung: Aber das ist doch jetzt so! Jetzt heißt es doch jeder
gegen alle. Wir leben doch jetzt in einer Ellenbogengesellschaft, oder
etwa nicht? Ich war schockiert. Aber er hatte völlig Recht.
Vor einigen Wochen fragte ich eine Studentin, ob
sie sich für eine Prüfung in einer Lerngruppe vorbereitet und ob ihr das
etwas gebracht hätte. Ich erhielt ich zur Antwort: Eigentlich nicht.
Die anderen haben ja nur versucht, von meinem Wissen zu schmarotzen. Da
habe ich gesagt, Leute lest doch selber die Bücher! Und sie hatte der
Gruppe den Rücken zu gekehrt. Es herrscht unter den Studierenden wie
wohl unter den Praktikerinnen der Sozialen Arbeit eine zunehmende
Tendenz zur Entsolidarisierung.
Außerdem herrscht eine große Bereitschaft, sich an unprofessionelle und prekäre Arbeitsbedingungen anzupassen.
Hintergrund hierfür ist zum einen eine große Angst
schon bei unseren StudentInnen, bei Nichtanpassung den eigenen
Arbeitsplatz zu verlieren. In der Praxis sind die Erfahrungen ja auch
entsprechend: Wer den Mund aufmacht, steht in Gefahr, rausgeworfen zu
werden. Es warten immer 2,3,4 andere SozialarbeiterInnen, die gerne den
freiwerdenden Arbeitsplatz eingenehmen würden ohne jede Aufmüpfigkeit
und zu allem bereit. Der Jugendamtsleiter, der offen sagte, dass er mit
dem zusammengestrichenen Budget nicht in der Lage sei, den rechtlichen
und fachlichen Ansprüchen der Jugendhilfe annähernd gerecht zu werden,
wurde auf der Stelle entlassen.
Ein anderer Hintergrund ist sicherlich auch die
gesamtgesellschaftlich induzierte Bereitschaft zur passiven Hinnahme von
prekären Lagen und die Nichtwahrnehmung und Nichtreflexion der
gesellschaftlichen Ursachen für diese Entwicklungen.
Vor diesem Hintergrund muss es wohl gesehen werden,
dass die in unserer Hochschule gezielt und intensiv geforderte
Auseinandersetzung mit den aktuellen problematischen Entwicklungen in
unserer Profession, von vielen Studierenden zunächst als sehr belastend,
als deprimierend erlebt werden. Sie verstehen oft nicht, warum wir als
HochschullehrerInnen sie in ein solches Dilemma verwickeln wollen: Wenn
die Praxis doch heute anders tickt, wenn die lebensweltorientierte
Soziale Arbeit gegenwärtig nicht gewünscht und nicht bezahlt wird, wozu
soll man sie dann noch lernen oder gar verteidigen?
Dennoch ist es uns gelungen, vielen Studierenden
die Augen zu öffnen, sie für die Probleme zu sensibilisieren und den
Wunsch bei ihnen zu wecken, sich den neoliberalen Anforderungen nicht
kampflos zu ergeben. Aber selbst solche Studierende, die verstanden
haben, mit welchen Problemen sie demnächst in der Praxis konfrontiert
werden, die die gesellschaftlichen Hintergründe begriffen haben und die
nicht mehr bereit sind, sich einfach anzupassen, selbst die entwickeln
keine Vorstellungen und Ideen für eine gemeinsame Gegenwehr. Die Idee,
sich zusammen zu tun, liegt auch für die eher Kritischen und
Sensibilisierten in weiter Ferne. Die Vorstellung vom Individuum, das
selber und alleine für sich kämpfen muss, steckt in allen Köpfen und
Poren.
Und dennoch bin ich inzwischen davon überzeugt,
dass ein elementares Bedürfnis nach Solidarität sehr wohl vorhanden ist
und rudimentäre, vielleicht auch erst einmal naive Vorstellungen über
mögliche Solidaritätsschritte innerhalb der Berufsgruppe vorhanden sind.
Es gibt nämlich durchaus das Bedürfnis bei Studierenden wie
Praktikerinnen, einen Weg für sich zu finden, der es ihnen ermöglicht,
den beruflichen Zumutungen und neoliberalen Herausforderungen nicht mehr
hilflos ausgeliefert zu sein. Sie suchen nach Möglichkeiten, nicht ganz
alleine zu sein bei ihrem Versuch, der Anpassung im Berufsleben zu
entgehen. Was sie sich denn wünschen würden für die Anfangszeit im
Beruf, in der neuen Stelle, in einer fremden Stadt, habe ich unsere
frisch gebackenen SozialarbeiterInnen gefragt. Die Antwort war
eigentlich viel versprechend: Wir hoffen, dass wir an unserem neuen
Arbeits- und Lebensort ein paar Leute finden werden, die genau wie wir
diese Probleme sehen. Mit denen möchten wir uns dann zusammensetzen,
austauschen und uns irgendwie gegenseitig unterstützen.
Solche Vorstellungen sind zweifellos noch weit von
der Idee einer Organisierung und von politischem, gemeinsamem Handeln
entfernt. Aber sie sind ein Anfang. Man sollte sie ernst nehmen. Sie
sind die Chance, die ergriffen und weiterentwickelt werden könnte.
Was wäre zu tun? Was könnte das solidarische Bewusstsein in der Berufsgruppe wecken?
Voraussetzungen für eine (Re-) Politisierung und (Re-) Solidarisierung der Sozialarbeiterischen Zunft sind aus meiner Sicht
- die Erkenntnis, dass die gegenwärtigen
Probleme der Klientel sowie die der Profession von Menschen gemacht
und keine unabwendbaren Naturgewalten sind,
- die Bereitschaft, sich zu wehren, für die
eigenen Interessen und Rechte einzusetzen und sich nicht
anzupassen, sich nicht treiben zu lassen, sei es aus Pragmatismus,
aus Faulheit oder aus Angst,
- die Bereitschaft und Fähigkeit, sich mit
Menschen gleicher Interessenlage und gleicher Gesinnung zusammen zu
tun und gemeinsam gegen die bestehenden Missstände anzugehen.
All diese Voraussetzungen sind heute bei den
meisten Studierenden und Praktikerinnen nicht oder nur sehr begrenzt
gegeben. Solche Erkenntnisse, solches Wissen, solche Erfahrungen sind in
unserer gegenwärtigen Gesellschaft offenbar weitgehend verschüttet,
ausgelöscht oder sie werden auch gezielt verheimlicht und verhindert.
Es gilt, sie neu zu schaffen und zu vermitteln.
Dies sind die aktuell anstehenden Aufgaben für die Gewerkschaften, den
Berufsverband und für die Bildungseinrichtungen. Für die Studierenden
liegen eine große Chance und damit auch eine große Verantwortung bei den
Hochschulen.
Dabei geht es um folgende Vermittlungsinhalte:
- Informationen über Möglichkeiten der Organisierung und über Interessenvertretungen,
- Sensibilisierung für die aktuellen
gesellschaftlichen Problemlagen und ihre Hintergründe, Aufklärung
über und Reflexion der politischen Zusammenhänge,
- Anregung zur Auseinandersetzung mit der
Frage, ob man sich diesen Entwicklungen wehrlos unterordnen will
oder ob man bereit ist, diese Anpassung zu verweigern.
Darüber hinaus aber ist es unbedingt notwendig, den
Betroffenen Erfahrungen mit Solidarität und mit gemeinsamem politischem
Handeln zu ermöglichen. Es sollte versucht werden, an den konkreten
Bedürfnissen nach Solidarität anzusetzen, an dem Wunsch, sich mit
Gleichgesinnten und gleich Betroffenen zusammensetzen und Austauschen
sowie stützen zu können.
Ich denke, viele Studierende wie PraktikerInnen
müssen ganz elementar erst einmal wieder erfahren, was solidarisches
Handeln ist, was ihnen das bringt, wie es geht und funktioniert. Das
kann innerhalb einer (berufs-)politischen Organisation geschehen, solch
eine Gruppe kann aber zunächst auch ganz spontan und persönlich zustande
kommen. Entscheidend ist, dass es für die Sozialarbeitenden einen Ort
gibt, an dem die Probleme ausgesprochen, nach ihren Ursachen hinter
fragt und Strategien für Lösungen entwickelt werden können. Ein Ergebnis
dieser gemeinsamen Überlegungen könnte sicher auch der Entschluss sein,
sich durch den Beitritt zu einer Gewerkschaft oder zum Berufsverband
weitere Ressourcen zu sichern und mehr Schlagkraft und Stärke zu
verschaffen. So verstanden wäre der Beitritt zur Organisation dann nicht
der vermeintliche Einkauf einer Interessenvertretungs-Dienstleistung,
sondern er wäre der Erkenntnis geschuldet, dass so ein Zusammenschluss
die Kräfte bündelt, Ressourcen stärkt und im Sinne einer großen, starken
Selbsthilfegruppe die eigene Durchsetzungskraft um ein Vielfaches
erhöht.
Literatur:
Böhnisch, L./Schröer, W./Thiersch, H. (2005): Sozialpädagogisches Denken. Wege zu einer Neubestimmung. Weinheim 2005
Bütow, B./Chassé, K.A./Maurer, S. (2006): Soziale
Arbeit zwischen Aufbau und Abbau. Transformationsprozesse im Osten
Deutschlands und die Kinder- und Jugendhilfe. Wiesbaden 2006
Galuske, M. (2008): Fürsorgliche
Aktivierung Anmerkungen zu Gegenwart und Zukunft Sozialer Arbeit im
aktivierenden Staat. In: Bütow, B./Chassé, K.-A./Hirt, R. (Hrsg.): Soziale
Arbeit nach dem Sozialpädagogischen Jahrhundert. Positionsbestimmungen
Sozialer Arbeit im Post-Wohlfahrtsstaat. Opladen 2008, S. 9ff
Heite, C. (2008): Soziale Arbeit im Kampf um Anerkennung. Professionstheoretische Perspektiven. Weinheim 2008
Lange, D./Thiersch, H. (2006):
Die Solidarität des Sozialen Staates Die Solidarität des reformierten
Sozialstaates. In: Böllert, K./Hansbauer, P./Hansenjürgen,
B./Langenohl, S. (Hrsg.): Die Produktivität des Sozialen den sozialen
Staat aktivieren. Sechster Bundeskongress Soziale Arbeit. Wiesbaden
2006, S. 211ff
Lutz, Roland: Perspektiven der Sozialen Arbeit. In: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 12-13/2008.
Nolte, P. (2004): Generation Reform. Jenseits der blockierten Republik. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn 2004
Spindler, H. (2007): Sozialarbeit und der Umgang mit der Armut. Eine alte Aufgabe im neuen Gewand. In: Forum Sozial 3/2007, S. 29ff.
Thiersch, H (1993).: Strukturierte Offenheit. In: Th. Rauschenbach u. a. (Hrsg.): Der sozialpädagogische Blick. Weinheim 1993, S. 11ff
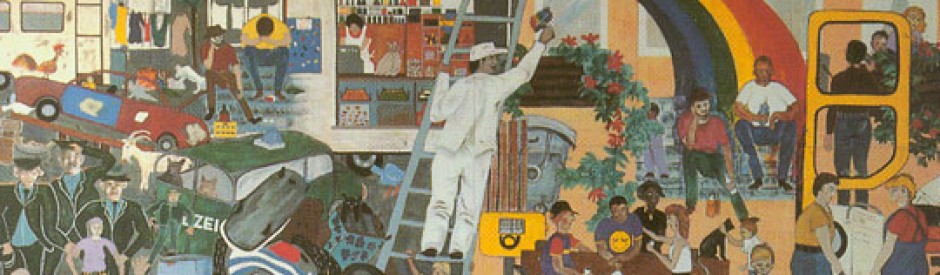



Bravo!