Wie kann man in der Praxis mit den Zumutungen und Anforderungen der Ökonomisierung umgehen, ohne sie einfach zu schlucken oder sich anzupassen?
Was ist z. B. , wenn das Qualitätsmanagement unendlich viel kostbare Zeit schluckt, die für die Arbeit mit den Klienten verloren geht. Aber es wird verlangt und braucht dazu noch mehr Zeit, als vorgesehen. Was tun? Manch einer reagiert auf solche Situationen mit Tricks. Man versucht, das Vorgeschriebene irgendwie schnell zu erledigen, aber dann die Zeit heraus zu arbeiten, die man für das braucht, was man für wichtiger hält. So merkt es keiner und man kann – heimlich – doch gute Arbeit machen.
IMeines Erachtens erweisen diese schlauen AustrixerInnen ihrer Profession einen Bärendienst: Sie signalisieren: „Alles in Ordnung!“ und riskieren, dass der Sozialen Arbeit der Hals immer weiter zugedrückt wird.
Hier ein Beispiel aus meinem Schwarzbuch:
Die Migrationsberatungsstelle in der Stadt M. hat zwei feste Mitarbeiterstellen à 30 Stunden. Daneben gibt es noch PraktikantInnen und einige ehrenamtliche BeraterInnen.
Bis vor eineinhalb Jahren hatten die hauptamtlichen Mitarbeiter für ihre Beratungen gerade mal die Zeit, die sie brauchten. Manches ging zwar schnell. Aber bei vielen MigrantInnen war eine langwierige Beratung nötig, weil allein die konkreten Informationen und ersten Hilfestellungen nicht gleich dazu führen konnten, dass die Betroffenen nun besser funktionierten. Im Vordergrund standen für die jungen MigrantInnen oft kulturelle Fremdheitsgefühle, unverarbeitete Erlebnisse in ihrer Heimat, Verständnisprobleme für die deutsche Bürokratie und Gesellschaft. Hinzu kamen oft auch einfach ganz persönliche Probleme und Belastungen, denen jeder Jugendliche ausgesetzt ist: Die Ablösung vom Elternhaus, die ersten Beziehungen usf. Die Arbeit in der Migrationsberatungsstelle erforderte sehr häufig, dass diese Probleme mit thematisiert und auch angepackt wurden. Andernfalls war das Ziel der Integration nicht zu erreichen. Dies aber bedeutete oft, mehrere Beratungsgespräche führen zu müssen, bevor mit konkreten Integrationsmaßnahmen und -schritten begonnen werden konnte.
Seit Beginn des Jahres hat der Träger neue verbindliche Rahmenbedingungen gesetzt, innerhalb derer für jeden Klienten nur eine begrenzte Zeit für freie Beratung zur Verfügung steht. Danach werden konkrete Ergebnisse mit der Methode Case Management erwartet, das auf praktische, konkret zu erfüllende Ziele ausgerichtet werden soll.
Was könnten die MitarbeiterInnen tun? Dass diese Begrenzung ihre Arbeit unsinnig einschränkt und die Qualität der Arbeit für viele Betroffene herabsetzen würde, war ihnen klar. Aber niemand hatte sie gefragt und auch niemand wollte sie hören.
Sie überlegten: Entweder, sie würden in Zukunft in jedem Fall darauf bestehen, schnell in das so genannte Fall Management einzusteigen und immer gleich hart und direkt an den konkreten Integrationsvorschlägen zu arbeiten. Dass sie dabei oft an ihren KlientInnen vorbei reden und sich ihre Bemühungen sinnlos im Kreis drehen würden, weil ganz andere Probleme und Themen die Mitwirkung der Betroffenen an den praktischen Lösungen blockieren, müssten sie dann in Kauf nehmen. Eine andere Lösung wäre es, bei nicht so belasteten Kunden Zeit herauszuarbeiten, also noch schneller als vorgesehen mit ihnen fertig zu werden, um so Zeitkontingente für die schwierigen Fälle intern zu sichern.
Ein schlauer Plan, der aber Monate später zu einem bösen Erwachen führte. Ende des Jahres konstatiert der Träger, dass es offenbar zu viele Fälle gegeben habe, bei denen doch eigentlich weniger Zeit nötig gewesen wäre. Deshalb könne man getrost die Rahmenbedingungen noch ein wenig enger fassen. Die zeitlichen Vorgaben werden weiter gekürzt.
Das Korsett wird immer enger. Irgendwann geht den MitarbeiterInnen die Luft aus.
Die Botschaft aber, die die MitarbeiterInnen durch ihren Trick an Geldgeber und Verwalter ihrer Arbeit gesendet haben, lautet: Die Zeit, die ihr uns gebt, reicht aus. Alles o. k. Wenn morgen weiter gekürzt wird, werden die Mitarbeiter ihre Kontingente noch gezielter und überlegter verteilen müssen dennoch bleibt immer weniger Zeit und die Arbeit verliert auf eine schleichende, nach außen hin kaum erkennbare Weise, an Qualität und Wirkungsmöglichkeiten.
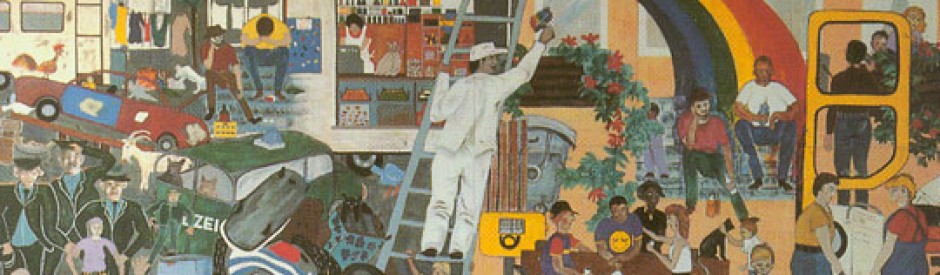




Bravo!